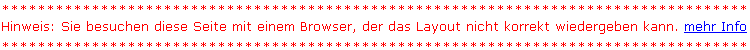Heft 15: Mut zur Bildung – Der Aufklärung verpflichtet
![]() 1985 |
Inhalt
| Editorial
| Leseproben:
1
&
2
1985 |
Inhalt
| Editorial
| Leseproben:
1
&
2

- Juni 1985
- 112 Seiten
- EUR 7,00 / SFr 13,10
- ISBN 3-88534-003-X
Höhenrausch und Alltagsfrust
Eine Polemik gegen die linke Gewohnheit, die Eigenlogik pädagogischen Handelns außer acht zu lassen
Dies ist ein längeres Papier geworden. Für den, der es schreibt, ist es ein gewisser Kraftaufwand, für den, der es lesen soll, immer auch eine Zumutung. Es ging nicht kürzer. Das wird damit zu tun haben, daß ich in kurzer Klarheit noch nicht sagen kann, was ich will. Etwas ausführlicher argumentieren zu können, hat es mir erleichtert, meine Gedanken schriftlich zu formulieren. Diese Gedanken entstanden für die Vorbereitung eines linken "Bildungstags".
Es geht mir darum, für die Geltung und Anerkennung eines eigenen pädagogischen Diskurses zu plädieren. Und das heißt: Ich wende mich dagegen, die Eigenlogik pädagogischer Reflexion und pädagogischen Handelns immer wieder durch andere Logiken (die ökonomische, die soziale, die psychologische) ersetzen zu wollen, also der Argumentationsgewohnheit zu folgen, den Aufweis der Bedingungen von Pädagogik für die Sache selbst zu nehmen. Ich will damit wohlgemerkt nicht meinerseits etwas ersetzen und für überflüssig erklären. Ich plädiere für eine Komplettierung der linken pädagogischen Diskussion, nicht für eine Verengung in die eine oder andere Richtung.
Meine Sprache ist oft programmatisch im Ton. Ich habe aber kein Programm. Meine Absicht ist eher metakritisch: Was wäre an Denk- und Argumentationsveränderungen nötig, damit pädagogische Reflexion begünstigt wird? Und um in dieser Fragerichtung weiterzukommen, arbeite ich mich an verschiedenen Gesichtspunkten ab, die ich als Schwachpunkte, als Bornierungen und Barrieren, innerhalb der linken pädagogischen Diskussion sehe.
Daß diese Diskussion keine einheitliche ist, liegt auf der Hand. Und der Leser mag gleich fragen: welche Linke meint er eigentlich? Ich kann das empirisch nicht genauer beantworten. "Linke Diskussion" und "linker Diskurs" sind in diesem Papier typisierte Gegenüber für meine Argumentation. Es gibt sie in dieser Reinform empirisch nicht. Sehr wohl aber gibt es Elemente und Momente davon in allen linken Projekten, Zirkeln, Arbeitskreisen und Praxismilieus. Ein heuristisches Vorverständnis dieses linken "Syndroms" setze ich beim Leser voraus.
Ich habe mich in dieser Darstellung auf ein Praxisfeld beschränkt, nämlich auf Schule. Die Bezüge zu anderen pädagogischen Arbeitsfeldern sind aber, glaube ich, unschwer herzustellen, da ich mich auf "Schwachpunkte" richte, die (leider) arbeitsbereichsübergreifend vorzufinden sind.
Ich habe meine Ausführungen in drei Abschnitte aufgegliedert:
KRITIK DES WISSENS nenne ich den ersten Abschnitt, in dem ich mich mit theoretisch-paradigmatischen Zugängen befasse, die in meiner Sicht Verkürzungen darstellen. KRITIK DER REDE heißt der zweite Abschnitt, in dem es um Argumentations- und Beschreibungsformen pädagogischer Arbeit geht, die meines Erachtens die Ausbildung einer brauchbaren Praxissprache verhindern. Im dritten Abschnitt schließlich, in einer KRITIK DER PRAXIS, beschäftige ich mich mit typischen Wahrnehmungs- und Interpretationsmustern, nach den üblicherweise die schulische Praxis, in erster Linie das Unterrichtsgeschehen, gedeutet und bewertet wird.
Mag sein, daß alles, was hier steht, nicht neu ist. Daß es vor allem in der alltäglichen Kommunikation der linken Lehrer längst seinen Platz hat. Ich habe das so noch nicht bemerken können, immerhin, die Hochschule kommt ja meist zu spät "an". Aber auch, wenn es nicht neu ist: es ist abgespalten vom "offiziellen" pädagogischen Diskurs der Linken, den ich wahrhaftig oft genug erlebe. Es muß dann erst noch seine Sprache finden, vielleicht gerade auf solchen Veranstaltungen der Selbstklärung, wie ein Bildungstag es werden könnte. Vielleicht kann ich zu dieser Versprachlichung von bereits Gewußtem etwas beitragen.
Ich beende diese Vorbemerkung, indem ich, zur Einstimmung sozusagen, einige Beobachtungen der letzten Zeit anführe, die nicht schön sind: Die linke pädagogische Literatur der späten sechziger und siebziger Jahre, die viele von uns ganz entscheidend beeinflußte, wird mittlerweile in den Wühlkästen des modernen Antiquariats angeboten. (Ich habe gehört, die Buchhändler zahlen nicht einmal mehr Geld dafür, sie nehmen bloß ab...) Lehrergewerkschaft, linke Organisationen, Grüne sind in ihren pädagogischen Verlautbarungen blaß bis nichtssagend. Ihnen scheint nichts mehr oder noch nichts einzufallen. Bei öffentlichen pädagogischen Diskussionsveranstaltungen erlebe ich nur allzu oft folgendes: Sobald jemand einen "linken" Standpunkt artikuliert bzw. einklagt, wird mir unbehaglich:
Es handelt sich dann leider wieder einmal um die Rücknahme eines erreichten Differenzierungsniveaus. Das Bedürfnis, die Diskussion in allseits bekannte Geleise zurückzuführen, schimmert durch. Man weiß immer schon vorher, was kommt. Das Publikum, so es dem Redner nahesteht, hat allenfalls Wiedererkennungs- und Bestätigungserlebnisse. Anlaß zum Nachdenken entsteht kaum. (Möge der geplante Bildungstag anders werden!). Daß ein Lehrer ein linkes Selbstverständnis hat, bietet keinerlei Gewähr, nicht einmal mehr Wahrscheinlichkeit, daß er ein besserer Lehrer als die anderen ist. Links zu sein, hat in der Pädagogik nichts mehr von dem, was wir früher ganz unbeschwert unterstellten, eine Art apriorisch höhere Eignung oder Qualifikation. - Wer eigene Kinder hat, muß Farbe bekennen. Fern aller Rhetorik stellt sich die Gretchenfrage: Will ich eigentlich, wenn ich darauf Einfluß habe, daß mein Kind vorzugsweise linke Lehrer hat? Oder liegt etwa das, was ich am Lehrer als wertvoll und wichtig empfinde, auf einer ganz anderen Ebene der Bewertung als der Frage nach dem "links". Dann wäre es zwar zu begrüßen, wenn der Lehrer überdies links wäre, aber das eigentliche Qualitätskriterium, um das es hier doch geht, läge innerhalb einer anderen Bewertungsskala. - Davon später mehr.
Kritik des Wissens
Linke Analysen des Bildungssystems und pädagogisch relevanter Praxisfelder orientieren sich vorzugsweise an zwei Paradigmen. Das erste Paradigma beansprucht, einen Totalitätsbezug herzustellen und System- und Ideologiekritik zu leisten. Es ist das Paradigma "Krisenverschärfung". Die Marxsche Emphase für die "wirklichen" Prozesse wird hierbei in der Regel so verstanden, daß die "wirkliche Wirklichkeit" im Rücken der Subjekte besteht, "hinter" den Bedeutungszuschreibungen und subjektiven Motiven der Handelnden, also in den objektiven Prozessen und Zusammenhängen. Die wirkliche Wirklichkeit ist in dieser Sicht im wesentlichen externer Funktionszusammenhang (extern bezüglich kulturell tradierter und subjektiv generierter Bedeutungen).
Schule und Ausbildung werden unter der Fragestellung "funktionale-Leistung-für" analysiert und auf diese Weise mit Kategorien wie gesellschaftliche Arbeit, Arbeitsmarkt, Qualifikationsstruktur, staatliches Subsystem in Bezug gesetzt. Das analytische Ergebnis kann bejaht werden (selten), zähneknirschend als Systemzwang hingenommen werden (die Regel) oder kritisch negiert werden (theoretisch leichter als praktisch). Worauf es mir hier ankommt, ist der funktionalistische Grundzug dieser Art von Fragestellung: Was braucht das kapitalistische System (der Arbeitsmarkt etc.)? - Wie stellt das System sicher, daß es bekommt, was es braucht? - In welchem Maße müssen wir uns diesem Zwang beugen? - An welchen Stellen können wir verhindern, daß das System bekommt, was es braucht?
Die Kategorien und Fragestellungen orientieren sich an der Logik von funktional aufeinander bezogenen Subsystemen (Beschäftigungssystem, Ausbildungssystem, schulisches System, Persönlichkeitssystem) und entsprechenden Steuerungsprozessen zwischen Ist- und Sollgrößen. Die Perspektive des Analysierenden und Erklärenden ist hier grundsätzlich eine von "außen", durch Deutungen und Motive der Schüler und Lehrer wird hindurchgesehen, um dahinter, im Rücken, zu finden, welche Steuerungsrichtung sich hier objektiv durchsetzt. Explosion des Zweiten Bildungsweges in den siebziger Jahren? Erklärung: Veränderte Qualifikationsnachfrage im Produktionsbereich. Das ist wahrscheinlich zutreffend. Aber es läßt beiseite, aus welchen Beweggründen, aufgrund welcher Selbstentwürfe jemand ein Bildungsbedürfnis entwickelt und seiner Lebensgeschichte gleichsam einen Schubs in eine neue Richtung gibt. Anders formuliert: Was ist die Binnengeschichte dieser Qualifikationsumstrukturierungen? Und auf solche Art von Frage könnte ich nur angemessen antworten, wenn ich paradigmatisch eine Binnenperspektive hätte, die Handlungen im jeweiligen Horizont der Akteure hermeneutisch nachkonstruiert.
In der funktionalistischen Außenperspektive sind (notwendigerweise) selbst Begriffe wie Sozialisation, Motivation, Bewußtsein steuerungstheoretisch zugeschnitten; Sozialisation, zum Beispiel, soll dann, in der Systemperspektive, "sicherstellen, daß..." bzw., in kritischer Sicht, "verhindern, daß..."
Was in dieser Perspektive zählt, sind funktionale Zusammenhänge, Leistungen-für-, Verhinderung-von-. Intersubjektiv geteilte Deutungszusammenhänge und subjektive Erlebnishorizonte werden der äußeren Wirklichkeit objektiver Prozesse unterstellt, sind also sekundär verglichen mit dem, was als wirkliche Wirklichkeit konzeptualisiert ist. Es schimmert hier, um es polemisch zu sagen, immer noch der Kultur- und der Subjektbegriff des offiziellen Marxismus der Dritten Internationale durch.
Natürlich kann man die funktionalistische Herangehensweise in der pädagogischen Diskussion auf alle aktuellen Themen ausdehnen - Leistungen-für-, Verhinderung-von-. Ich kann fragen: Was leistet Schule für die Schärfung ökologischen Bewußtseins oder für die Erhaltung des Friedens? - Das Problem liegt in der spezifischen Reduktion. Ich frage nach Ergebnissen, nach Wirkungen, nach Einwirkungsmöglichkeiten-auf-; ich vernachlässige Bedeutungen, Gründe, Motive. Es ist immer klar, was "herauskommen" soll; das "notwendige" Bewußtsein oder Verhalten ist quasi Zielgröße. Bewußtsein und Verhalten stehen aber nicht nur in objektiven, kausalen Bezügen, sondern - da Menschen nicht "Natur", nicht physikalische Einheiten sind - immer auch in semantischen und psychodynamischen Bezügen. Auf dieser Ebene frage ich nicht nach Ursache-Wirkungs-Ketten oder Funktionen, sondern nach Bedeutungen und nach Sinngehalten: Was "bedeutet" eine Handlung oder eine Aussage im Kontext einer Lebensform und im Horizont einer Lebensgeschichte? Und diese Bedeutung ist ja nicht etwas, das "hinzu" gekommen ist (und von dem ich deshalb unbeschadet absehen könnte), sondern sie konstituiert Handlungen und Aussagen allererst. Schüler, um es auf Pädagogik rückzubeziehen, sind in Bedeutungsnetze verwickelt, die erheblich vieldeutiger sind, als es Konzepte annehmen, die geradeheraus "ändern" wollen, und sei es in lauterster Absicht.
Ein Lehrer will im fünften Jahrgang Friedensbewußtsein herstellen. Er läßt die Schüler eine Stadtlandschaft in denkbar schrecklichstem Zustand anfertigen, nämlich so, wie sie nach einem atomaren Angriff aussieht - eine ascheverregnete Todeswüste. Bestürzend. Der Gong ertönt, die Stunde ist um, der Lehrer verläßt den Raum. Was machen die Kinder während der Pause: Sie spielen Bomberpilot, steigen in der Phantasie wieder und wieder in die aufheulenden Maschinen und greifen die Stadt an!
Ich will mit alledem nicht sagen, das Paradigma Krisenverschärfung sei in seiner funktionalistischen Perspektive falsch oder überflüssig. Wesentliche gesellschaftliche Prozesse setzen sich in der Tat langfristig wie tagtäglich hinter unserem Rücken durch, und um sie zu begreifen, ist es unerläßlich, die Perspektive eines Beobachters von außen einzunehmen. Allerdings wende ich mich entschieden gegen die Vorstellung, die (funktionalistische) Außenperspektive und die (kultur- und subjekttheoretische) Binnenperspektive stünden in einem Subsumptionsverhältnis, die erste Wirklichkeit sei gewissermaßen wirklicher als die zweite. Nein, es ist ein und dieselbe Wirklichkeit, zu der es keinen privilegierten Königsweg gibt, sondern unterschiedliche, und gleichberechtigte, paradigmatische Zugänge.
Die Funktionen von Schule zu analysieren, ist (zum Beispiel) das eine - die Bedeutungen von Schule zu interpretieren, das andere. Beides geht nicht ineinander auf. Es ist nicht einzusehen, warum linke Theorie, was die Dimension der Bedeutungen angeht, naiv oder grobschlächtig argumentieren muß.
Nun ist es in der linken Diskussion zumeist offenkundig gewesen, daß die Beschränkung auf das funktionalistische Paradigma eine handlungstheoretische Lücke läßt, die geschlossen werden muß. Es wird aus diesem Grunde häufig komplettiert durch ein zweites Paradigma, nämlich das Paradigma "Widerstandspotentiale". Das thematische Interesse richtet sich hier auf politische, soziale und subkulturelle Bewegungen sowie auf Anzeichen latenter "Widerständigkeit" (wie in jüngster Zeit etwas eigenartig ontologisierend gesagt wird).
Auch dieses Paradigma, so meine ich, birgt in sich die Tendenz, eine wirkliche Wirklichkeit zu konzeptualisieren, die einen prinzipiell höherrangigen Status zugesprochen bekommt: diesmal ist es das Widerständige. Andere Aspekte der Wirklichkeit müssen sich mit dem Status der Vorform begnügen, der ihnen (immerhin!) schulterklopfend zugestanden wird. Zum Beispiel Interessen an Rockmusik, oder Alltagsklatsch, Fußballbegeisterung, Null-Bock-Sprüche - all dies gerinnt in dieser Perspektive zum Bodensatz, zur Vorform von Protest, Widerstand, politischem Bewußtsein. Es wird latenter-Ausdruck-von, verstecktes-Moment-von, kurz: Potential.
Es liegt nahe, daß, wer sich an das Paradigma "Widerstandspotentiale" hält, insbesondere den Weg identifikatorischer Praxisbeschreibung und -interpretation geht. Es entstehen so Studien, die sich auf die Alltagspraxis von Schülergruppen, unterprivilegierte Jugendlichen, linke Lehrerzentren konzentrieren, in den letzten Jahren vor allem auf jugendliche Ausdrucksstile und auf die Neuen Sozialen Bewegungen. - Als erfreulich empfinde ich bei solchen Arbeiten die Zurückhaltung in politischer Zensurengebung, die Liebe fürs Ausdrucksdetail, wie sie wahrscheinlich vom Blick des Ethnologen gelernt worden ist. Ärgerlich, jedenfalls in meiner Sicht, ist der fast apriorisch feststehende Wille zur positiven Interpretation. In einer extrem bemühten Hermeneutik wird noch aus jedem banalen Diskobesuch, dem sich die Autoren angeschlossen haben, das widerständige Minimum einer Schulklasse oder Lehrgangsgruppe hervorgeholt.
Ich kann mich nur schwer des Verdachts erwehren, diese Art von Wissen würde in erster Linie erzeugt, um (imaginäre) Bündnisangebote vorzubringen oder um eigene Identitätssicherung zu betreiben: Die idealisiert Beschriebenen - seien es break dancer, Haus-besetzer, Punks - bekommen einen ästhetischen Status des Nichtidentischen zugeschrieben, auf den die Betreffenden vermutlich postwendend und dankend verzichtet, wenn sie diese Beschreibungen lesen würden.
Auch hier ist meine Behauptung nicht, dieses Paradigma sei falsch oder überflüssig. Die Analyse politischer, sozialer und kultureller Protestbewegungen ist wichtig. Nur sollten wir uns bewußt bleiben, wie sehr solch ein Paradigma die Wirklichkeit von einem Punkt, von einem Erkenntnisinteresse her aufgreift und insoweit eine gravierende Fokussierung der Wahrnehmung bedeutet. Schlimm ist das Extrem: Wenn unter der Hand eine Art ontologisches Schichtenmodell impliziert ist, mit der Kategorie Politisches Bewußtsein als höchster Seinsform, den Potentialen und latenten Ausdrucksformen als mittlerer Schicht und den Lebensformen in ihrer profanen Alltäglichkeit als defizitärer Bodensatz und Rohstoff fürs Höhere. Das ist scholastisch und nicht materialistisch.
Ich will an dieser Stelle eine Zwischenbemerkung einschieben: Ich gehe noch einmal zurück zur Dominanz des funktionalistischen Paradigmas innerhalb des linken pädagogischen Diskurses. Diese Dominanz hat meines Erachtens mit dazu beigetragen, daß bildungstheoretische Ansprüche fast nur noch in der Schwundform eines soziologischen Realismus artikuliert werden.
Wenn an die Stelle von Bedeutungen Funktionen treten, an die Stelle von Gründen Ursachen und an die Stelle von Motiven Ziele - dann ist das nicht nur eine theoretische Einebnung, sondern es entsteht die Gefahr, daß die Systemlogik selbst übernommen wird. Es ist nämlich geradezu die negative Utopie des Kapitalismus, jegliche kulturellen und subjektiven Prozesse soweit als möglich steuerungstechnisch zu begreifen und zu beherrschen.
Auf einer solch einseitigen Linie liegt es dann nahe, die Gehalte eines hermeneutischen Bildungsbegriffs durch sozialisationstheoretische Pädagogikkonzepte zu ersetzen. Die Sozialisationstheorie hat theoriegeschichtlich eh eine funktionalistische Schlagseite. Sie fragt geradeheraus: Wie wird jemand zu dem gemacht, der er ist? (Und die Linke war angezogen vom hohen Gehalt an Machbarkeit, der in dieser Sichtweise nahegelegt wird.) Die bildungstheoretische Frage, die es lohnt, neu zu durchdenken, lautet hingegen: Wie macht sich jemand zu dem, der er werden will? Es geht in dieser Frage nicht um eine Logik von Geprägt-werden-durch-die-Umwelt, sondern um den Prozeß der Individuation als Vergesellschaftung, also: wie übernimmt jemand kulturell und innersubjektiv seine vergangene und zukünftige Lebensgeschichte?
In einer solchen bildungstheoretischen Perspektive wäre die "linke" pädagogische Frage nicht beschränkt auf "Was braucht ein Kind oder Jugendlicher heute?" Sondern sie hieße: Worauf hat ein jeder ein Recht, obgleich er es nicht "braucht"? Diese Frage richtet sich also auf ein "Mehr", das überschüssig ist zu den funktionalen Notwendigkeiten der Lebensbewältigung.
An diesem Punkt könnte ich mißverstanden werden. Die Forderung nach einem "Mehr" könnte, wenn man sie umstandslos auf die Unterrichtswirklichkeit überträgt, nach einer weiteren Anspruchssteigerung klingen. So meine ich es nicht; ich will hier nicht in den Chor derer einstimmen, die - zumal von der Hochschule aus - mit immer neuen ambitionierten Forderungen an die Adresse der Lehrer aufwarten. Das "Mehr" im obigen Satz meint nicht "Steigerung", sondern "Öffnung". Daß den Lehrern von der Staatsseite her ständig mehr abgefordert wird, ist mir bekannt. Unsere Sichtweise zu öffnen, bildungstheoretisch zu öffnen, hieße, daß die linke pädagogische Diskussion nicht alles auf "Vorbereitung" zuschneidet, daß sie unter dem Gesichtspunkt des "Brauchen-für-später" nicht noch eifriger wird als Schulaufsicht und konservative Elternschaft, oder gar diese zu überholen trachtet. Ich will mit der Zwischenbemerkung hier nicht fortfahren. Für eine Diskussion, was man unter einem "Mehr" als "brauchen" einklagen sollte, benötigen wir jedenfalls ein kulturtheoretisches Verständnis von Lebensgeschichte (unter einer Binnenperspektive), das andere Akzente setzt als ein funktionalistisches Konzept von Sozialisation (unter einer Außenperspektive).
Beide Paradigmen, das funktionalistische der "Krisenverschärfung" und das parteiliche der "Widerstandspotentiale", ergänzen sich in ihrer jeweiligen Einseitigkeit auf ungute Weise darin, einen differenzierteren Zugang zu kulturellen und subjektiven Phänomenen zu verstellen. Einmal werden diese funktionalistisch subsumiert, ein andermal bewegungsteleologisch überhöht. Um es metaphorisch zu sagen: Mir sind die funktionalistischen Analysen zu kalt und die identifikatorischen Bewegungsdiagnosen zu heiß.
Ich fürchte, es rächt sich mittlerweile, was einmal die Stärke und Vitalität des linken pädagogischen Wissens gewesen ist: es war ein Kampf- und Bewegungswissen. Von politischen und sozialen Gegenkräften über Jahre gebeutelt, ist nun ein Defensivwissen daraus geworden. Solch ein Wissen ist in Gefahr, zu erstarren und in erster Linie bloß noch der eigenen Identitätssicherung zu dienen.
Da wird auf die gegnerische Position gestarrt, inkarniert in der (neo)konservativen Wende, und jeglicher Diskurs danach befragt, ob er diesem Gegner schadet oder nützt. In jeder Diskussion findet sich ein Warner, der die Denkgrenzen anmahnt: "Ich halte es für ganz gefährlich, wenn hier..." Daß es darüber hinaus einschneidende Weiterentwicklungen in Sozialwissenschaften, Kulturtheorie und Philosophie gibt, wird kaum zur Kenntnis genommen. Die Wirklichkeit ist komplexer als es die Imagination eines großen Matches zwischen Linken und Wende-Vertretern suggeriert. Und die Theorien sind es auch. Angriffseuphorie hat früher, Defensivität führt jetzt zur Rücknahme an Differenziertheit.
Da wird weiterhin jegliche Denkfigur an einem strategischen Apriori gemessen: Gibt dieser Gedanke uns eine Richtung? Was sind die Potentiale, Mittel, Zielpunkte? Als stünden wir auf einem Feldherrenhügel, kurz davor, wieder einmal die ganze Schlachtrichtung anzugeben. - Ein Neigung zu Klipp-Klapp-Mechanismen bleibt bestehen. Keine Uneindeutigkeiten, keine Offenheiten, keine Ambivalenzen - das schwächt die Entschlossenen und verwirrt die Unentschlossenen. Klipp-klapp, das heißt immer wieder: entweder- oder; wenn nicht so, dann doch wohl so; wenn du gegen dieses bist, dann bist du für jenes. Jedes Phänomen, jede Frage ist im Lichte dieses Denk- und Argumentationsmechanismus in Gefahr, von einem Punkt her gedacht zu werden, der rigoros eingenommen oder genauso rigoros fallengelassen werden muß.
Das führt zu einem Verlust an Deutungspotential. Wobei nach meinem Eindruck das linke pädagogische Wissen sich seinerseits noch einmal in einem sektoralen Rückstand befindet, wenn man es an vergleichsweise vitalen Diskussionen um Arbeit, soziale Klassen, Kultur und Ästhetik mißt. Das linke pädagogische Wissen erfährt einen Entwertungsschub nach dem anderen. Es vermag auch kaum noch, den pädagogisch Arbeitenden eine Zufuhr an Selbstwertgefühl zu bieten , wie dies in früheren Jahren durchaus der Fall gewesen ist.
Aber wir sind in diesem Prozeß nicht bloß Opfer gegnerischer Attacken. Die Wissens-Fallen, in die wir hineintappen, sind auch selbst aufgestellt.
Kritik der Rede
Die Gewohnheiten und Formen, in denen über pädagogische Praxis geredet, gestritten, reflektiert wird, können selbst zu einem Problem werden. Erziehung und Lernen sind jahrelang als Gegenstände strategischen Veränderungswissens aufgefaßt worden. Ein solcher strategischer Wissenstypus hat einen inneren Zug in Richtung deduktiver Ableitungsketten. Je zwangsläufiger Kausalketten aussehen, desto mehr wächst die Suggestion der Wirksamkeit und der Absicherung des eigenen Handelns. Was zunächst der Festigung des eigenen Selbstverständnisses dienen mag, wird irgendwann einmal ausgesprochen kontraproduktiv. Fast alle Äußerungen bekommen den Charakter von Legitimationsfragen ("Wie könnt ihr rechtfertigen, daß...") und Legitimationsantworten ("Es geht uns darum sicherzustellen, daß auf jeden Fall..."). Derjenige, der die Fragen stellt, hat es dabei erheblich leichter; er kann mit wenigen, teils recht schlichten und immer gleichen Fragefiguren Verunsicherung erzeugen, Überlegenheit demonstrieren und nicht zuletzt auch symbolische Macht ausüben. Diejenigen, die zur Antwort veranlaßt sind, haben es schwerer. Sie müssen gesteigerten Begründungsansprüchen Rechnung tragen. Das schaukelt sich dann wechselseitig hoch, bis man als Pädagoge soweit ist zu versichern, ein Tonbandinterview, das Schüler mit Straßenpassanten durchführen, ziele auf die Erkenntnis der Veränderbarkeit der gesellschaftlichen Realität und so weiter und so weiter. Die linke pädagogische Rede dient dann der Einübung in Rechtfertigungsfiguren, die man geradezu komisch überhöht finden könnte, wenn sie nicht so traurige Gründe hätte. Unter der Hand findet hier politische Sozialkontrolle statt. Die schmerzhafte Ahnung der Pädagogen, über Jahre hinweg größenwahnsinnigen Erwartungen gefolgt zu sein, führt jetzt zum schlechten Gewissen in der Selbstbewertung der eigenen Arbeit. Und so wird sie, auf letztlich durchschaubare Weise, rhetorisch überhöht.
Der andauernde Überhang der Legitimationsfrage führt zur wahnwitzigen Überhöhung von Begründungsniveaus. Und eben dies verhindert die Ausbildung einer tauglichen Praxisrede. Eine solche Rede wäre nicht hermetisch gegen Nachfragen abgeschottet, sondern erfahrungs- und insbesondere ambivalenzoffen (was die vielgedruckten sogenannten Erfahrungsberichte meines Erachtens nicht sind). Ein solches Redeklima erlaubt auszudrücken, daß ich selbst noch nicht genau sagen kann, was ich tue und was dabei herauskommen soll - ohne daß die Legitimierungsprofis wieder ihre deduktiven Fallbeile niedersausen lassen und ohne daß die "Parteilichen" wieder gute Beispiele aufzählen.
Längst rituell erstarrte Formeln, wie "Die Schüler sollen durch xyz zu kollektivem solidarischen Handeln befähigt werden, um ihre eigenen objektiven Interessen wahrnehmen zu können", sind nicht falsch, aber pseudo-tauglich. Auch wenn sie längst niemand mehr so recht ernst nimmt, haben sie problematische Effekte. (Ich bitte also, mir nicht schulterklopfend anzuraten, diese Formeln seien von mir wichtiger genommen als sie es in praxi sind.) Sie sind pseudotauglich, weil sie Absicherungs- und Wiedererkennungsfunktionen erfüllen und die Leerstellen der wirklichen Praxisbegründung und -interpretation verkleistern. Denn diese Rede ist eine Programmsprache, eine Ziel- und Anspruchssprache. Man kann sich sehr daran gewöhnen. Was sich nach Beschreibung anhört, ist in Wahrheit oft die Wiederholung von Absichten.
Natürlich bleibt es über kurz oder lang nicht aus, daß sich diese Sprache unerträglich inflationiert. Sie wird hohl wie ein Festtagsjargon: Noch während der eine Kollege auf der Konferenz gesellschaftsverändernde Wirkungen beschwört oder über Schülerbetroffenheit mutmaßt, erzeugt er bei den Umsitzenden einen ganzen Klangteppich halblauter sarkastischer Kommentare. Die Kehrseite des Begründungspathos ist der Zynismus. Beides, offizielle Rhetorik und informeller Verriß, kommen aber nicht zueinander, sondern koexistieren abgespalten voneinander, können also auf immer weiterleben.
Eine Variante dieser Art Rede will ich kurz gesondert erwähnen. Sie bedient sich des erprobten rhetorischen Mittels, die eigene Position dadurch zu stärken, daß man die andere und gegnerische Seite um so drastischer verzeichnet. Ein beliebtes Übungsfeld ist hier die Kritik an der Schule als Institution. Die Metaphern überschlagen sich geradezu: mit den tayloristischen Lernfabriken begann es, steigerte sich zu Leistungsterror, Erziehungsknast und Sozialisationsverbrechen. Dies alles, um Schule kennzeichnen zu wollen... Nichts gegen Rhetorik, aber hier wird als Kategorien ausgegeben, was in Wahrheit fahrlässige Metaphorik ist. (Und diese Metaphorik geht, nebenbei gesagt, in jüngster Zeit natürlich gut mit der schrillen Dauerempörung der Antipädagogen zusammen.) Wer metaphorisch so zulangt, braucht gar nicht mehr genauer hinzusehen. Der Kopf ist nicht erhellt, aber erhitzt; das reicht manchem schon.
Zurück zum Anspruchs- und Legitimationsniveau. Mein Eindruck ist, daß der andauernde Überhang der Legitimationsfrage für die betreffenden linken Lehrer ein Paradoxon nach Art der Double-bind-Falle darstellt. Versteht sich ein Lehrer "bloß pädagogisch", so ist alles, was er anstrebt, bereits entwertet. Er will zu wenig. Da die Arbeit trotzdem seine Kraft kostet, wird er depressiv. - Versteht sich ein Lehrer "politisch", so ist alles, was er erreichen kann, immer nicht genug. Er bewirkt zu wenig. Und da die Arbeit trotzdem seine Kraft kostet, wird auch er depressiv.
Das heißt, die Kehrseite von strategischen Argumentationsketten, deduktiver Zielformulierung, legitimatorischer Anspruchserhöhung ist die Depressivität der alltäglichen Selbstwahrnehmung, in die sich eine Unzahl von Lehrern hineinmanövriert hat (oder hat manövrieren lassen) und aus der sie nun schwerlich herauskommt.
Ein anderes Folgeproblem linker pädagogischer Rede: Eine Stärke, aber leider auch strukturelle Begrenztheit linker Analysen liegt in der Spezialisierung auf eine bestimmte Form der Kritik - nämlich der Abwehr autonomie-beeinträchtigender Bedingungen und Maßnahmen. Anlässe für eine solche Abwehr gibt es wahrhaftig genug. Aber aus der dauernden empirischen Veranlassung wird unter der Hand eine konzeptionelle Reduktion. Die linke pädagogische Rede spezialisiert sich so auf Entfremdungsdiagnostik. Sie ist im wesentlichen Kritik der Be- und Verhinderungen pädagogisch-politischen Arbeitens. Das wird dann problematisch, wenn es die Vorstellung fördert, die Negation dieser Beeinträchtigung sei konzeptionell bereits hinreichend. Dahinter steht dann nämlich implizit die Annahme, die richtige pädagogische Praxis sei gleichsam ein bereits daseiender Kern, dem lediglich zur Entfaltung verholfen werden muß, indem Stück für Stück die entfremdeten externen Bedingungen in Abzug gebracht werden. - Diese Argumentation zehrt von der lebensphilosophischen oder moralistisch getönten Dichotomie Lebendigkeit (des Praxiskerns) versus Institutionalisierung.
Analog zur Vorstellung eines solchen guten "Kerns", der nur freigelegt zu werden braucht, gibt es eine Argumentationsfigur, die von einer weiteren Dichotomie getragen ist, nämlich der von Wirklichkeit versus Institution. Ohne viel Federlesen wird der direkte Zugriff der Schule auf den Alltag, das Leben, den Stadtteil, auf das wie immer konzeptualisierte "Draußen" als non plus ultra anempfohlen. Ist, auf der Ebene der deduktiven Bedingungsanalyse, der gesellschaftliche Zusammenhang zunächst als Inkarnation der Entfremdung gekennzeichnet worden, so wird er nun - in einer eigenartigen pragmatischen Volte - zum Füllhorn erfahrungssättigender Lernmöglichkeiten. Auch hier die implizite Annahme eines richtigen Kerns - die Wirklichkeit stecke voller Anregungsgehalte, sofern man aus jeglichen didaktischen, pädagogischen und institutionellen Vermittlungs- und Aneignungsformen heraustreten und sich gewissermaßen in der Reinform des common sense auf sie einlassen würde. - Ich halte beide Implikationen eines richtigen "Kerns" für problematisch.
Zur ersten Annahme: Richtige pädagogische Praxis kann zureichend nicht allein aus einer Entfremdungsdiagnose und deren Negation entwickelt werden. Um pädagogisches Handeln zu konzeptualisieren, muß ich - in einer analytischen Denkbewegung - auch vom Repressions- und Entfremdungskontext abstrahieren können, um allererst genuin pädagogische Kategorien und Interpretationskriterien zu gewinnen. Andernfalls habe ich gar kein zureichendes Verständnis davon, "was" da eigentlich eingeschränkt, behindert, unterdrückt oder zerstört wird. Auf Tagungen und Seminaren kann man die Grenzen dieses Vorgangs umgehend erleben, wenn zum x-ten Male der Vorschlag gemacht wird, sich gegenseitig die Repressionserfahrungen am eigenen Arbeitsplatz zu schildern, und dies den Praxisbezug gewährleisten soll. In Wahrheit stellt sich der Effekt ein, mögliche Praxisreflexion auf vertraute Geleise zu bringen; man tauscht aus, was man kennt.
Was wir brauchten, wäre - um es im Bilde zu sagen - eine Tunnelbohrung stets von zwei Enden her, von der Seite der empirischen Entfremdungsdiagnose und -kritik und von der Seite eigener pädagogischer Vorstellungen und Entwürfe her. (Wie dünn es mit dem zweiten Aspekt, den eigenen Vorstellungen und Entwürfen, bestellt ist, kann man bereits daran ermessen, daß es eine eigene Diskussion, was ein guter Lehrer ist und was ein ungeeigneter, überhaupt nicht gibt. Als ob die Misere der (Nicht-)Einstellungspraxis des Staates derartige Kriterien insgesamt entbehrlich gemacht hätte!)
Zur zweiten Annahme: Pädagogisches Handeln soll sich selbstverständlich auf soziale und auf innersubjektive Wirklichkeit beziehen. Es muß sich dem gegenüber also "öffnen". Aber das soll doch nicht heißen, sich dieser Wirklichkeit zu unterwerfen. Pädagogisches Handeln ist kontrafaktisch. Das umstandslose Aufgehen von Lernsituationen in Alltagsrealität wäre kein linkes Vorhaben, sondern ein positivistisches. (Und in der kulturellen und politischen Diskussion der letzten Jahre ist ja von den vermeintlich utopischen Konzepten, die die Veralltäglichung etwa von Kunst, Sexualität, Feier, Arbeit propagierten, wohl auch zu Recht der Lack ab!) Mir scheint nicht mehr die Öffnung zur Wirklichkeit das gegenwärtige drängende Problem zu sein, sondern fast umgekehrt: Kinder und Jugendlichen ihrer sozialen und psychischen Realität quasi realitätsfixiert auszuliefern, und sei es unter dem lauthals verkündeten Verzicht auf pädagogische Bevormundung. Jeder soll halt möglichst früh sehen, was er aus sich und seiner Realität macht. - Ich meine hingegen, gerade die schmerzhafte Unmittelbarkeit der sozialen und psychischen Realität abfedern zu helfen, wird zu einer schwierigen - problematischen - , aber dennoch unabweisbaren Aufgabe pädagogischer Praxis. "Abfedern" heißt nicht Behüten-vor, sondern in der Wirkung relativieren. Pädagogik bezieht sich dann gerade auf das, was man in und an der Wirklichkeit nicht "von alleine" lernt, was nicht auf der Hand liegt, was des Anstoßes, des Umwegs, der reflexiven Brechung bedarf. In diesem Sinne sollte, wie ich sagte, Pädagogik kontrafaktisch sein. Sie könnte Subjekte darin unterstützen und bestärken, der sozialen und psychischen Faktizität etwas entgegenzusetzen. Insoweit ist sie nicht Exekutierung, sondern gerade Verfremdung und Brechung der Realitätsnähe.
Das linke pädagogische Wissen, davon war bereits die Rede, beansprucht Totalitätsbezug und Parteilichkeit. Die Schwundform dieses Anspruchs sind allerdings Deutungsmuster, die quasi-moralisch daran erinnern wollen, daß alles mit allem zusammenhängt. Gibt es ein Problem, so entgegnet man mit der Neigung, Ursachen und Kontext dieses Problems für die Sache selbst zu halten: Indem ich dir sage, wo es herkommt, ist das Problem gelöst.
Lehrer schlagen sich mit Problemen herum, die ihrem Alltag eine spezifische Anstrengung verleihen, es sind vor allem solche, die sie mit den Schülern im Unterricht haben. Es ist beileibe nicht überflüssig, sie ausdrücklich zu nennen: Langeweile, Unkonzentriertheit, Undiszipliniertheit, Lerndefizite, aggressives und destruktives Verhalten. - Ich behaupte, dies sind die eigentlichen Anstrengungen im Lehreralltag. Wie gesagt, wohl kaum etwas Neues.
Und doch ist dies in der Praxisprogrammatik der Linken nicht repräsentiert. Oder genauer: diese Probleme dürfen offiziell nur thematisiert werden, sofern sie im gleichen Atemzug durch Ebenenwechsel (auf Verursachung und Kontext) quasi wegdefiniert werden. Kausal- und Kontexterklärungen werden so zum Ersatz dafür, sich mit den situativ auftretenden Problemen selbst zu befassen. Langeweile, Unkonzentriertheit, Undiszipliniertheit, Lerndefizite, aggressives und destruktives Verhalten stellen aber für den Lehrer Handlungsprobleme heftigster Art dar, denen er zu allererst seine persönliche Autorität entgegenstellen muß (ob man das Wort nun mag oder nicht). Diese Probleme aber gehen in der Konstatierung ihrer Genese und Verursachung nie auf. Und jeder Lehrer erfährt das täglich und stündlich.
Aber vor dem Hintergrund des enormen Moralitätsdrucks, der innerhalb des linken pädagogischen Diskurses besteht, kann man nachvollziehen, daß die Thematisierung dieser Probleme in sehr hohen Maße mit Ambivalenz belegt wird. "Es gibt diese Probleme - aber wo kommen sie her?!" - (Es ist schon schwer vorstellbar, daß im Ästhetikbereich jegliches Arbeitsproblem durch seine sozialisatorische oder institutioneile Vorgeschichte wegerklärt würde; oder im therapeutischen Bereich etwa Suchtproblematik nur als Suchtvorgeschichte thematisiert werden dürfte.) Die gängigste Argumentationsfigur ist die, man dürfe nicht "an den Symptomen" ansetzen. Aber machen wir uns klar, was das heißt: Da das, was "nicht Symptom" ist, sondern Ursache, ausdrücklich als außerpädagogisch definiert wird, schlägt sich mit solchen Deutungen ein Berufsstand, der doch "pädagogisch" ist, die Handlungsmittel selbst aus der Hand. Die scheinbare gesellschaftspolitische Radikalität ist hier in Gefahr, einem schlichten Nichtstun oder Wegsehen das Wort zu reden. Ich kann nur sagen : Doch, an den Symptomen ansetzen, wo denn sonst?
Wieder handelt es sich um eine Abspaltung. Programmatisch werden die hauptsächlichen Handlungsprobleme entschärft oder sogar wegdefiniert - der Alltag indessen ist voller Anstrengung, Streß, oft sogar Depression. Man müßte einmal politisch motivierte Verlautbarungen und private Telefonäußerungen gegeneinanderhalten können, oder auch Gremienrhetorik und Krankmeldungen!
Viele scheitern an dieser Abspaltung, wenn auch in unauffälliger Weise. (Wobei die politischen Aktivisten und die Funktionsstellen-Menschen die angeführten Handlungsprobleme vielleicht wirklich weniger haben, weil sie sich einen viel selbstverständlicheren Umgang mit Macht und Entschiedenheit angewöhnt haben.) Ich frage mich, wieviele der "gewöhnlichen" Lehrer vor dem Betreten des Klassenraums tatsächlich oft Angst haben.
Pädagogische Interpretations- und Handlungsfähigkeit erlangt der Lehrer nur, wenn in seine kontrafaktische Kritik die Schüler im Grundsatz mit einbeziehbar sind. Auch dies sagt sich rasch, ist aber im Kontext linker pädagogischer Rede alles andere als unumstritten. Die moralistische Aufladung des eigenen Selbstverständnisses tendiert, zumindest in der offiziellen Rhetorik, zur Parteinahme für die Schüler in Form eines eigentümlichen Jugendschutzes. Die Schüler gelten in dieser Sicht als sakrosankt. Deren Handlungsmuster und deren Selbst- und Situationsdeutungen zum Gegenstand von Kritik zu machen, wird in der antipädagogischen Linie als Anmaßung klassifiziert. Hinzu kommt die nach wie vor verbreitete Unkenntnis strukturalen Denkens: Alle Subjektkritik wird dann als "psychologisch" eingeordnet und gerät in die Nähe des Verdikts "unpolitisch"; als gäbe es nicht eine Subjektkritik die gerade auf trans-subjektive Realitäten abzielt (Wissensformen, Deutungsmuster, lebensweltliche Kontexte), die sich zwar an und in Subjekten zeigen, jedoch mit Psychologie nicht verwechselt werden dürfen!
Die vielzitierten Betroffenen bereits kategorial der Kritik zu entziehen, stellt eine praktisch kaum durchzuhaltene Position dar. Sie bedarf einer projektiven Bedeutungsaufladung der Schülerseite, um so gegen die viel ambivalenteren Konflikterfahrungen in der Realität abzuschirmen. Im sozialpädagogischen Blick werden die Schüler so zu Opfern; im ethnologischen Blick zu Wilden; im moralischen Blick zu Unversehrten und im ästhetischen zu Nichtidentischen. Je heftiger die projektive Ausstattung mit Qualitäten, die sich aus der Ambivalenz des Selbstbildes der Lehrer speisen, um so immuner ist die Wahrnehmung gegen Widerspruchserfahrungen. Es gibt Lehrer, die von den Wohnformen Berliner Hausbesetzer schwärmen und sich selbst ein Eigenheim vom Munde absparen. Die Kinder, Jugendlichen, Schüler haben auf längere Sicht nicht einmal einen Vorteil davon, denn Ambivalenzunfähigkeit der Erwachsenen ist gefährlich: wer Schüler projektiv idealisiert und dann doch einmal nachhaltig enttäuscht wird, der rächt sich dafür... Ich glaube, die Schüler haben eine Antenne dafür und sind diesen Stilisierungen gegenüber durchaus kühl und skeptisch.
Es gibt noch eine andere jugendschützerische Haltung, mit entgegengesetzter Ausrichtung. Sie folgt dem Motto: Was ich in einer Situation nicht billigen kann, muß ich in jedem Falle abstellen oder ich mache mich schuldig.
Hier wird unterschlagen, daß die Interessenanlage und Deutungsperspektive der Schüler eine eigenständige ist. Und in dieser Eigenständigkeit ist sie völlig legitim und verständlich. Die schulischen Situationen sind nie eindeutig definiert, schon gar nicht nur funktional, auf den institutionellen Zweck, den Unterricht hin. Auseinandersetzungen mit Schülern sind insofern immer auch ein Streit um Situationsdefinitionen. Die Institution beansprucht: Dies ist eine Lernsituation . Die Schüler antworten: Das wollen wir doch erst einmal sehen. - Die Schüler nehmen sich das Recht, ihr inneres Engagement zu dosieren. Nicht selten begrenzen sie ihre Erwartungen an den Lehrer ganz offen instrumentalistisch, wie in der Fahrschule: Vermittle uns diese oder jene Kenntnisse, nicht mehr und nicht weniger; fertig; ohne soziale Verpackung. Auch diese Begrenzung sollte nicht politisch-moralisch als Rückzug etc. diskriminiert werden. - Und die Schüler erwarten nicht zuletzt handwerklich guten Unterricht, der sich aus seiner Qualität heraus begründet und nicht aus Metaebenen (zum Beispiel aufgrund menschlicher Vorzüge des Lehrers oder außerschulischen Engagements).
Man kann sehen: Die Schülerdeutungen sind mehrspektivisch, wechselnd und in sich widersprüchlich. Einerseits: Schule soll doch nicht nur Schule sein; andererseits: Schule soll bloß Schule bleiben. Dies Wechselbad kann für den Lehrer eine aufreibende Beanspruchung sein.
Für den Lehrer ergibt sich hieraus eine Schlußfolgerung: Auch er sollte zu "Wechselbädern" in der Lage sein, nicht nur notgedrungen, sondern als qualitative Grundlage seiner eigenen Deutungen und Handlungen. Ich will erklären, was ich meine:
Das Wissen des Lehrers besteht, idealtypisch ausgedrückt, in einer Gleichzeitigkeit von Totalitätswissen, Kontextwissen und Handlungswissen. Wenn ich von Gleichzeitigkeit spreche, so kann ich mir eine ungeeignete vorstellen, die sich blockierend auswirkt, und eine geeignete Gleichzeitigkeit, die produktiv ist.
Was wäre eine ungeeignete Gleichzeitigkeit? - Es wäre dies einmal die Vorstellung eines deduktiv-abzuleitenden Zusammenhangs: Habe ich das rechte Totalitätswissen, so ergibt sich hieraus das Kontextwissen und hernach das Handlungswissen. Ich stelle alles und jedes in den "gesellschaftlichen Zusammenhang" und erweise mich mit diesem Verfahren als guter Lehrer. Hier wird die Eigenlogik des Kontext- und des Handlungswissens unterschätzt. Die Vorstellung des ableitbaren Wissens kann zu einem Vorab-Wissen führen, das vermeintlich immer schon Bescheid weiß und dem Besonderen einer Situation eine prinzipiell geringere Bedeutung zumißt als dem Verallgemeinerbaren.
Ein anderer Effekt ist die Neigung zur Substitution. Ich weiche den Schwierigkeiten einer Wissensebene dadurch aus, daß ich sie durch eine andere ersetze. Wenn Totalitätswissen gefragt ist, klage ich ein: Was nutzt mir das im Klassenraum? Wenn Handlungswissen gefragt ist, rekonstruiere ich gesellschaftliche Gesamtzusammenhänge. Die gleichzeitigen Wissensebenen in meinem Kopf blockieren eher, als daß sie produktiv gemacht würden. Der alles Bedenkende ist so handlungsunfähig wie der Handlungsfixierte reflexionsfeindlich ist.
Ich stelle mir demgegenüber eine geeignete Gleichzeitigkeit von Totalitäts-, Kontext- und Handlungswissen vor. Sie ist eher gestalttheoretisch zu konzipieren. Die Gestalttheorie (eine wahrnehmungspsychologische Schule; nicht identisch mit der Gestalttherapie!) hat sich u.a. mit dem changierenden Verhältnis von Figur und Grund beschäftigt, wie im bekannten Beispiel der Vexierbilder, in denen, je nach Umschlagen der Perspektive, etwas als Vorder- oder als Hintergrund fungieren kann. So wie hier die Figuren kippen, wechselseitig füreinander Vorder- oder Hintergrund bilden, indem ich die Sehweise umstelle, könnte auch mit den angeführten Wissensebenen umgegangen werden. Totalitäts-, Kontext- und Handlungswissen können - je nach situativem Erkenntnisinteresse - füreinander den Vorder- oder Hintergrund bilden. - Diesen Ansatz hat auch die Phänomenologie aufgenommen, indem sie von Verschiebungen des Thema/Horizont-Verhältnisses spricht. Der Horizont bildet den - unverzichtbaren - Verstehenshintergrund für ein jeweiliges Thema.
Ich hoffe, es wird deutlich, worauf ich hinaus will. Eine Wissensebene kann für die andere dann - je nach Kontext - den Horizont bzw. das Hintergrundwissen bilden. Und das ist dann etwas anderes, als mit der geläufigen Warnung gemeint ist, nichts abzuspalten oder nichts auszublenden. Es ist gleichwohl immer die Entscheidung für einen bestimmten Vordergrund. Und damit tun sich eben viele doch schwer.
Wenn ein Schüler, ob listig oder arglos, seine Rechtschreibfehler damit erklärt, daß er eben Arbeiterkind sei, muß ich als Lehrer in der Lage sein, dies zwar als Kontextwissen anzunehmen, aber es in der Handlungssituation im Hintergrund zu lassen. Ich muß mich um die Schreibfehler selbst kümmern, ich darf sie nicht substitutiv wegdefinieren. Gleichwohl ist es nicht erforderlich, deshalb den sozialisatorischen Kontext aus meinem Wissen zu löschen.
Ich hoffe, man kann sehen: Der ärgerliche Effekt der Klipp-Klapp-Gewohnheit ist auch an dieser Stelle nicht zwingend. Der Lehrer braucht weder der große Zampano zu sein, der immer alles Wissen gleichzeitig aktiviert, noch jemand, der auf die bornierte Hier-und-Jetzt-Perspektive festgenagelt bleibt. Die klare Entscheidung, was kontextuell jeweils im Vordergrund steht, ist allerdings unverzichtbar. Und dem widerspricht die linke Anspruchsgewohnheit, stets alles mit allem zu verbinden. "Das kann man doch nicht trennen!", war eben über Jahre die beliebteste argumentative Allzweckwaffe. Trennen wird hier eher als Auseinanderreißen gedacht, wahrscheinlich im Assoziationshof des klassischen Entfremdungsbegriffs, der es stets mit "Trennungen" zu tun hat. Trennen kann doch aber auch heißen: Unterscheiden können, Einstellungen verschieben, situativ angemessene Prioritäten setzen. Wer dies nicht will oder nicht kann, ist meines Erachtens sowohl intellektuell wie handwerklich als Lehrer zum Scheitern verurteilt. Und man wird solch Scheitern nicht einmal als tragisch bezeichnen können, denn es ist vermeidbar.
Kritik der Praxis
Ich habe weiter oben bereits zu einem Bild gegriffen, um meine Vorstellung von pädagogischer Reflexion zu verdeutlichen: Wie bei einer Tunnelbohrung sollten wir uns von zwei Enden her vorarbeiten, von der Analyse der empirischen Schul- und Unterrichtsrealität her, und dies wird in der Tat in hohem Maße Entfremdungsdiagnostik sein; aber eben auch von der anderen Seite her, der Seite, die - analytisch herausgetrennt - eigene pädagogische Vorstellungen entwirft und begründet. Die erste Zugangsweise dominiert im linken Diskurs, wir haben uns an sie geradezu gewöhnen können. Ich will deshalb für meine weiteren Ausführungen die zweite wählen (und lasse mir somit bewußt den Vorwurf der "Realitätsferne" gefallen). Ich will einige Gesichtspunkte anführen, die sich bei der Frage nach einer gelingenden pädagogischen Praxis des Lehrers stellen.
Was tut der Lehrer im gelingenden Falle? Ich will einmal einen Lehrer entwerfen. Ich werde ihn "meinen Lehrer" nennen, damit deutlich bleibt, daß er mein Konstrukt ist, daß es ihn in der Empirie so nicht geben kann.
Mein Lehrer macht einen spezifischen (das heißt: begrenzten) Kompetenzvorsprung, den er hat, produktiv. Er vermag dies, indem er in (s)einen Gegenstandsbereich einführt und dabei über Vermittlungsempathie verfügt. Das heißt er bewegt sich zwischen der Logik des Gegenstands und der Logik der Subjekte, also ihrer Rezeptionshorizonte, Aneignungsgewohnheiten und subjektiven Verarbeitungsstrukturen. Mein Lehrer geht also in der Logik des Gegenstandes nicht auf. Er vermittelt Gegenstände stets in-Beziehung-zu. (Hochschullehrer, die demonstrieren können, daß sie in der Logik des Gegenstandes aufgehen, sind oft ärgerlich schlechte Lehrer. Dem Niveau ihres Fachwissens entspricht dann leider das Niveau ihrer Vermittlungsreflexion überhaupt nicht.) Mein Lehrer tritt aber auch der steten Gefahr entgegen, daß die Gegenstände von den Schülern ins schon "Bekannte" aufgelöst werden, er subjektiviert die Situation nicht vollends, er macht neugierig gerade auf das Fremde. Im geglückten Falle verhilft mein Lehrer also zu einer durchaus ungewohnten Lösung. Er hilft, die Gegenstände ein Stück weit zu subjektivieren und die Subjektivität ein Stück weit zu vergegenständlichen, so daß zwischen dem fremden Gegenstand und der nahen Subjektivität etwas Neues entsteht: ein Drittes, nämlich ein Gegenstand der mit objektiver Bedeutung und (!) mit subjektiver Bedeutsamkeit belehnt werden kann. Im geglückten Falle (den ich weiterhin unterstelle) tritt ein überschüssiges Ergebnis ein. Die angeeigneten Gegenstände finden nicht nur als solche Interesse, sondern der Weg zur Lösung wird modellhaft interessant. Die (immer noch angenommene) Identifikation mit dem Lehrer zielt dann nicht auf dessen Gegenstände, sondern auf dessen Art, mit ihnen umzugehen. Die Identifikation ist, könnte man sagen, struktureller Art, bindet nicht an dieselben Gegenstände oder an die empirische Person, sondern lernt von der Art des Gegenstandsverhältnisses. Und manchmal geht es dann sogar um Leidenschaften! Solche Identifikation erlaubt Ablösung. Das Vermögen, eben dies zu ermöglichen und zu befördern, könnte man, im besten Sinne des Wortes, die Professionalität meines Lehrers nennen. Sie ist einerseits nicht identisch mit Fachwissen, andererseits aber auch nicht mit dem oft mystifizierten Anspruch an "Persönlichkeit".
Mein Lehrer tritt der Verlockung des "kürzesten Weges" entgegen. Er plädiert für den Umweg, für den denkbaren Befriedigungsgehalt des Neuen, gegen die Reduktion auf das Bekannte und das, was ich schon kann. Um es einen Moment lang in psychoanalytischer Rede zu sagen: Mein Lehrer plädiert für die Arbeit an der Wahrheit, und das heißt hier, Wahrheit hinsichtlich dessen, was ich noch nicht vermag. Er verstellt mir - in verkraftbarer Weise - die regressive Verleugnung meines Mangels bzw. des schmerzhaften Bruchs, der zwischen meinem Ideal und meinen derzeitigen Ich-Fähigkeiten besteht. Mein Lehrer macht einen Unterschied zwischen zwei subjektiven Positionen, die sich zum Verwechseln ähnlich sehen: zwischen Bedürfnissen und Ich-Abwehr. Ich-Abwehr besteht in eingelernten und zunehmend verfeinerten Mechanismen, mit denen ich mir sekundäre Unlust, insbesondere Kränkungen meines Ideals und meiner Allmachtansprüche, ersparen will. Ich-Abwehr ist die Stimme, die mir zum kürzesten Weg rät, zurück in die Risikolosigkeit des Vertrauten.
Soweit und so knapp in psychoanalytischer Rede. Ich kann diesen Gesichtspunkt hier nicht ausbreiten, sondern nur kurz kommentieren. Ich weiß natürlich, daß jeder der eben apodiktisch gesagten Sätze überaus mißbräuchlich gelesen werden kann. Die Unterscheidung zwischen Bedürfnissen und Ich-Abwehr ist kategorial leider ebenso zentral wie in praxi heikel. Solch eine Unterscheidung kann man nicht direkt "anwenden", sondern man kann von ihr wissen und damit zumindest die eigene Aufmerksamkeit und die eigene Rede differenzieren. Ich finde, das ist schon etwas! - Linke Pädagogen orientieren sich an der politischen Wertungsdichotomie von Selbstbestimmung und Fremdbestimmung. Und sie nehmen dabei zurecht, wenn immer es geht, die Position "Selbstbestimmung" ein. Das ist ihr demokratisch emphatischer Impetus. Das Schwierige ist, daß zur Unterscheidung Selbst-/Fremd-Bestimmung die Unterscheidung Bedürfnis/Ich-Abwehr durchaus quer liegt. Das eine Paradigma ist das der "Demokratie", das andere, das psychoanalytische, ist das Paradigma der innersubjektiven "Wahrheit". Beide lassen sich nicht einfach kombinieren, denn sie beißen sich gewissermaßen. Das "Ich" der demokratischen Selbstbestimmung ist emphatisch, es ist Träger artikulierter Bedürfnisse und hat Legitimität, soweit es sich mit den Anderen ausgleicht. Das psychoanalytische "Ich" ist nicht emphatisch, sondern ihm wird mißtraut, es artikuliert nicht nur Bedürfnisse, sondern auch, zumal in getarnter Form, Angst, es hat nur Legitimität, insoweit es sich der inneren Wahrheit stellt. Dieses Ich kämpft mit sich selbst.
Ich sehe schon das Stirnrunzeln des Lesers vor mir. Soll der Lehrer sich anmaßen, in diesen - und dann noch verborgenen - Kämpfen den Schiedsrichter zu spielen, was der psychischen "Wahrheit" entspricht und was nicht? - Nein, das meine ich nicht, und es wäre auch in unerträglichem Gegensatz zum Paradigma der Demokratie. Aber, bitte auch hier keinen Klipp-Klapp-Mechanismus. Der Lehrer kann nicht Schiedsrichter über die Wahrheit sein, aber ich muß deshalb nicht ins andere Extrem verfallen, und das wäre: alles, was ein Schüler äußert, ist "Bedürfnis". Ich spreche davon, den kürzesten Weg zu "verstellen", das heißt, mein Lehrer stellt sich dieser regressiven Option entgegen. Er ergreift Partei innerhalb der Ambivalenz des Schüler-Ichs, die er nur unterstellen kann. Er bietet seine Parteinahme an. Was die psychische Wahrheit des Schülers ist, wird er nicht entscheiden können und wollen, das muß der Schüler letztlich selbst tun. Der Lehrer ist, indem er die Ambivalenz aktualisiert, unbequem, aber er versucht, Gegenbefriedigungen anzubieten.
Im progressiven und liberalen Milieu wird dieses Widerspruchsfeld paradoxerweise komplizierter (und tritt zum Beispiel in Alternativen Schulen oder in offener Jugendarbeit deutlich zu Tage, weil hier der ungebrochene Anspruch besteht, sich an den "Bedürfnissen" der Kinder bzw. der Jugendlichen auszurichten). Das politisch-reflexive Niveau und die Thematisierungsmöglichkeiten, die hier den Jugendlichen kulturell zur Verfügung stehen, um Unbehagen an äußeren Anforderungen und Zumutungen zu artikulieren, sind gewachsen. Die Fähigkeit zur Bedürfnisartikulation (Paradigma Demokratie) wächst hier ebenso wie die Möglichkeit der Begründung von "kurzen Wegen", die etwas ersparen (Paradigma psychische Wahrheit). In solch selbstreflexiven Milieus wird die Palette für Rationalisierungsmöglichkeiten auch subtiler. Man kann sich im Rekurs auf Entfremdungstheorie und Zivilisationskritik (zum Beispiel Ideologiekritik der Selbstdisziplinierung) als kompetent zeigen und gleichzeitig Erfahrungen der Unlust und des längeren Weges ersparen. Ich kenne eigentlich niemanden, den das auf längere Sicht zufrieden macht; ich kenne aber viele, die es trotzdem unaufhörlich so halten. Die sind dann irgendwann gerade auf das progressive und liberale Milieu überhaupt nicht gut zu sprechen...
Mein Lehrer ist kein Therapeut. Das steht nicht im Widerspruch zum eben Ausgeführten. Der Therapeut fördert gerade die Regression (um mit ihr arbeiten zu können). Mein Lehrer, eben weil er sich bewußt bleibt, kein Therapeut zu sein, ist gehalten, Regression zu verstellen. Das ist seine Aufgabe. Er arbeitet nicht an den psychischen Tiefen (aber er stellt in Rechnung, daß es sie gibt). Er arbeitet allerdings struktural, also an den sozialkognitiven Mustern, mit denen die Schüler sich selbst und die Welt deuten. Er arbeitet mithin gegen Deutungsmuster, die der Verlockung des kürzesten Weges entgegenkommen, sie abstützen oder gar zum Programm erheben. In diesem Sinne ist mein Lehrer den Schülern gegenüber oppositiv. Er versucht, sie zu verstehen, aber Verstehen heißt nicht immer, einverstanden zu sein.
Mein Lehrer ist, mit Verlaub, hart im Beharren auf dem Gegenstandsbezug, und er ist weich im Verständnis der Gegenstandsbedeutung. Er ist also gegen die softe Auflösung der Gegenstandslogik und er lastet sie auch nicht entschuldigend nur den äußeren Zwängen an. Er ist aber andererseits gegen die rigide Bedeutungsfestschreibung der jenigen Pädagogiken, die sich allzu emphatisch am orthodoxen Arbeitsbegriff ausrichten.
Mein Lehrer will gerade Bedeutungsspielräume eröffnen, statt sie zu verengen. Auch die vielbeschworene Betroffenheit will er aus zu enger Bedeutung herausnehmen helfen, schon gar nicht, sie durch gesteigerte Drastik der Themen oder Vorgehensweisen erzwingen. Wer mit dem Rücken an die Wand gedrückt wird, lernt nämlich nicht am besten, auch wenn diese Wand "Betroffenheit" heißt. Die Schüler haben ein Recht auf die Möglichkeit, den Selbstbezug, da, wo er ihnen die Luft abschnürt, auch lockern zu können. Der höchste Realitätsdruck ist selten der günstigste Lernkontext; zumindest muß er abgefedert werden können. Schule ist so gesehen ein Raum für Probedenken und Probehandeln. Wer das als Spielwiese diskriminiert,sollte die Schüler gleich in die Büros und Fabriken schicken. Dann hat die Realität endlich ganz gesiegt. Oder auf die Parkbänke für die Arbeitslosen.
Die Gegenstände, die die Schule behandelt, sollten von uns nicht nur nach Kriterien einer politisch-moralischen Verpflichtung zum Realismus bewertet werden. Die Welt ist den Schülern, vor und neben der Schule, in hohem Maße "bekannt". Vermeintlich kennen sie alles schon, und darin steckt heute ein mindestens ebenso großes Problem wie im Nichtwissen. Das vermeintlich Vertraute muß erst unvertraut gemacht werden, um es sehen zu können (Horst Rumpf). Die "Welt" muß, so paradox es klingt, heute erst entkonventionalisiert werden, bevor sie vermittelt werden kann. Die sekundären Erfahrungen (über Medien im weitesten Sinne vermittelte Erfahrungen) sind "immer schon da" und müssen allererst erschüttert und verflüssigt werden.
(Ich könnte mir übrigens vorstellen, daß diese Einsicht auch dazu führt, ästhetische Kategorien, die sich auf ein "Sehen-lernen" richten, höher zu bewerten, als dies bislang im Rahmen linker Pädagogik der Fall gewesen ist.)
Wohlgemerkt, dies ist kein Vorschlag für einen Wechsel der Gegenstände, "weg von der Realität". Nicht die Gegenstände sollen ausgewechselt werden, sondern die Bearbeitungsperspektive. (Die jugendschützerische Sorge, die Realität werde von den Schülern womöglich vergessen, erscheint mir eh nicht begründet.) Vielleicht müssen wir heute Entfremdung viel eher mit dem Kleben am Bekannten assoziieren, während das neu gewonnene Fremde die Chance birgt, von Entfremdung fortzuführen.
Mein Lehrer teilt nicht die pseudo-intuitive Geringschätzung von Techniken. Schreiben, Gitarrespielen, Drucken, um einiges zu nennen, basieren auf der Beherrschung von Techniken. Ausdrucksvermögen und Intensität beruhen so gut wie nie auf vortechnisch bleibender Intuition, von der dann gesagt wird, sie dürfe nicht eingeengt werden, sondern sind nach-technisch erwachsende Möglichkeiten.
Wer keine Technik beherrscht, bleibt immer ans Klischee gefesselt, er macht nach kürzester Zeit immer dasselbe. Aber auch hier bitte keinen Klipp-Klapp-Mechanismus: wieder liegt die Wahrheit nicht im blanken Gegenteil. Denn wer die Techniken qua Dressur gelernt hat, ist entweder ihnen gegenüber affektiv blockiert oder er kann seine Kompetenz nie wieder individuieren und subjektiv verflüssigen; dann entstehen fest verankerte Kreativitätsbarrieren.
Vielleicht hat die Geringschätzung von Techniken die ja auch vorliegt, wenn man meint, bloß der Arbeitsmarkt-Vorbereitung zu geben, was sie fordert, vielleicht hat diese Geringschätzung folgenden Grund: Es gibt derzeit eine massive Reaktualisierung von lebensphilosophischen Wertstandards, die für eine Kritik an Industrialismus und Technologie verwendet werden. Dann wird ein scharfes Gegensatzverhältnis von Technik (als Ausdruck von Entfremdung) und Echtheit aufgestellt. Gerade das Antitechnische ist hier Ausdruck von Authenzität. Aber ich muß sagen, das sieht mir nach schlichter Begriffsverwechslung aus. Der Technikbegriff, von dem ich spreche, hat seinen Ursprung in der antiken Techné und meint das Wissen von einer Kunst oder Fertigkeit. Er meint nicht fortschreitende Arbeitsteilung und -Zerlegung zum Zwecke serieller Produktion. Auf jegliche Techné zu verzichten, wäre beileibe nicht etwa praktisch gewordene Industrialismuskritik, sondern schlicht Verzicht auf Kultur!
Die - in der Regel wohl nicht beabsichtigte - Rückkehr zu lebensphilosophischen Bewertungsschemata - hie Vitalität, dort mechanistische Technik; hie gemeinschaftliches Innen, dort gesellschaftliches Draußen - hat auch das Formale in den Bannkreis negativer Assoziationen gezogen. "Bloß formal" kam in der nicht-orthodoxen Linken immer schon einem Schimpfwort gleich, gegen das "das Inhaltliche" ausgespielt wurde. Und nun wird die Verachtung des Formalen wohl eher durch die Wiederkehr des "Natürlichen" besiegelt.
Mein Lehrer teilt diese Bewertung nicht. Er überschätzt nicht den Wert und die Funktion prozeduraler Regeln, aber er ist fern davon ihre weitgehende Abschaffung zu betreiben. Natürlich gilt es, sich der Verbehördung der Schule entgegenzusetzen. Der Erosion von Tradition, die seit den sechziger Jahren auch durch unser Betreiben zu verzeichnen ist, folgten ja nicht Freiräume, sondern vermehrt Verrechtlichungsschübe, die nun administrativ-bürokratisch bis ins Kleinste festzulegen suchen, was bis dato durch ungeschriebene Gesetze schlicht und einfach "galt". - Aber, wieder begegnen wir dem vertrauten Klipp-Klapp, das muß nicht heißen, die völlige Informalisierung der Schule anzustreben. Denn die wäre eine Familialisierung. Daß das nicht durchsetzbar ist, ist klar, aber es ist auch nicht wünschbar. Prozedurale Regeln sind eben nicht nur Zwangsnetze, sondern auch ein Stück symbolische Realität. Als solche halten sie in Erinnerung, daß die intersubjektiv geteilte Situation nicht einfach die Summe x subjektiver Befindlichkeiten ist. Schule ist Vergesellschaftung. Die Ansprüche "der Anderen" treten dem einzelnen auch in Form trans-personaler Regeln gegenüber. Bei aller Herrschaftskritik, analytisch gesehen hat diese Transpersonalität ein richtiges Moment. Andernfalls wäre jeder Augenblick ein sozial voraussetzungsloser Nullpunkt, der durch persönliche Überzeugungsakte und Aufeinanderabstimmen aller subjektiven Motive gestaltet werden muß. Mag sogar sein, daß das geht, aber der Preis ist sehr hoch. Denn, prozeduralen Regeln zu folgen, beschränkt ja nicht nur mein Handeln, sondern entlastet es auch, stellt psychische und soziale Energie frei, die ansonsten in einem kommunikativen Dauerkraftakt gebunden bliebe. (Keine Wohngemeinschaft überließe die Abwaschfrage nur der situativen Klärung...)
Nicht ob formale Regelungen legitim sind, ist eigentlich die Frage, sondern in welcher Weise sie Zustandekommen, wie sie geändert werden können und wie mit Regelverstößen umgegangen wird.
Schule sollte nicht familialisiert werden. Und die Interaktion mit den Schülern ebenfalls nicht. Wo dies als Wunsch da sein mag, da werden gelingende Beziehungen der Beteiligten nach einem Paradigma "Nähe" imaginiert. "Nähe" will die ganze Person, zumindest die horizontale Verbreiterung von emotionalen und identifikatorischen Gemeinsamkeiten.
Mein Lehrer hingegen ist geleitet vom Paradigma "Intensität", nach dem gelingende Situationen imaginiert werden. "Intensität" will ausdrücklich nicht, und auch nicht tendenziell, die ganze Person einbeziehen, will nicht Verbreiterung von Gemeinsamkeiten, sondern punktuelle Verdichtung in Situationen (und damit Begrenzungen).
Es ist, zugegeben, eher ein ästhetisches Paradigma als ein psychologisches oder politisches. Aber immerhin belehrt uns gerade die Konzeption von psychoanalytischer Technik, daß Intensität und institutioneller Rahmen sich nicht ausschließen müssen. Sie kann als Beispiel dafür stehen, daß Regeln nicht ein symbolisches Gefängnis sein müssen. Die psychoanalytischen Therapiesitzungen sind qua Absprache grundsätzlich auf den stündlichen Rahmen begrenzt. Niemand wird in Abrede stellen, daß sie sehr "intensiv" sein können. Und doch würde kein Analytiker im Traum daran denken, einfach einmal eher zu schließen oder länger zu machen...
Der Vergleich mit diesem Beispiel hat seine Grenzen (und ist nicht wörtlich zu nehmen, ich will damit nicht die strikte 45-Minuten-Schulstunde empfehlen), Schule ist, wie gesagt, keine Therapie. Mir ging es darum, die assoziative Koppelung von prozeduralen Absprachen mit Entfremdung, Formalismus, Langeweile - kurz mit dem Gegenteil von Intensität - einmal zu relativieren. Das formale Regelnetz engt nicht nur ein, es entlastet auch und kann sogar Energie freisetzen bzw. entbinden. Mein Lehrer braucht nicht als "ganze Person" zu agieren. Und darum ist er hin und wieder zur Intensität in der Lage. Ich vermute, daß auch die Schüler das zu schätzen wissen.
Ich komme auf die Eingangsbemerkung zu diesem Abschnitt zurück: Meinen Lehrer gibt es nicht. Er ist, so wie ich ihn entwarf, ein Konstrukt. Denn die Verhältnisse, wir wissen es, die sind nicht so.
Und dennoch halte ich solche Gesichtspunkte für besprechenswert. Wollen wir denn, daß ein Lehrer so wäre? Darüber kann man doch durchaus diskutieren. Und damit kann man pädagogische Interpretations- und Bewertungsbegriffe abklären. In der Entfremdungsdiagnostik werden wir uns nämlich oft schneller einig, wir zehren vom Konsens über das Negative und lernen hieraus wenig hinzu. Und wir wissen am Ende nicht mehr recht, welche Gesichtspunkte, die wir kritisieren, auf das Konto der Verhältnisse gehen und welche auf eigene konzeptionelle und praktische Unzulänglichkeiten.
Die Alternativschulen, und einiges verstehe ich davon, sind ein deutliches Beispiel dafür, was alles "ungelöst" zu Tage tritt, wenn die institutionellen Zwänge, auf deren Kritik wir uns normalerweise spezialisiert haben, "fort" sind. Ich tue den Alternativschulen sicherlich nichts Böses an, wenn ich ganz trocken festhalte, daß dann nicht schon das Problem gelingende Schule zu seinem positiven Abschluß gekommen ist.
Einen letzten Gesichtspunkt will ich noch kurz nennen, den ich auch im Interesse der Entlastung der Lehrer formuliere, und zwar lediglich als formale Mahnung: Die Komplexität der innerschulischen Willensbildung und Herrschaftsmechanismen hat enorm zugenommen. Das hat sicher auch zu tun mit der (seinerzeit ganz anders gewollten) Reformhypothek, die institutionalisierte Mitbestimmungsformen und Verrechtlichung aller schulischen Maßnahmen eigenartig zusammengeschlossen hat. Im Vergleich zu den heutigen Schulen, insbesondere den Gesamtschulen, ist ja, sagen wir ein Gymnasium der sechziger Jahre, geradezu ein Dorado an administrativer Einfachheit. Von der Tendenz her geht die Schule heute einem Modell der Dauerkonsultation aller mit allen entgegen (was noch nichts über Mechanismen und Wege der Machtausübung besagt). Das kostet Kraft und Zeit. Wer mehr "Komplexität" vorschlägt und sie institutionell verankert sehen will, der sollte sagen, wo er auf der anderen Seite "Sparmöglichkeiten" sieht. Jeder, der heute noch einen schulpolitischen oder schulpädagogischen Veränderungsvorschlag in die Welt setzt, gleich welcher politischen Motivierung, sollte verstummen und in sich gehen, wenn die ausdrückliche oder unausdrückliche Nebenfolge seines Vorschlags ist, daß sich für die Lehrer eine weitere Belastungsausweitung einstellt. "Mehr" geht da nicht mehr.
Mein Papier soll Ausdruck der Überlegung sein, daß gegenwärtig nicht nur immer auf der Ebene organisatorischer und institutioneller Veränderungsprogramme nachgedacht werden muß, sondern auch auf der Ebene uns lieb oder ärgerlich gewordener Einstellungs- und Bewertungsmuster. Auch die sind ein Teil zäher Realität, die der Bearbeitung wert ist.
Ich schließe damit. Es gibt noch eine letzte Frage. Diejenigen, an deren Adresse ich dies hier aufgeschrieben habe, werden vielleicht sogar geneigt sein, sie in den Rang einer Gretchenfrage zu setzen: Gibt es überhaupt eine Pädagogik, für die die Kennzeichnung "links" einen Sinn macht? Ist es vielleicht, je näher man hinschaut, eine tautologische Bezeichnung für "gute" Pädagogik? Ich muß gestehen, ich bin da unsicher. Linke Bildungspolitik, das kann ich leichter füllen als die Frage nach einer linken Pädagogik. Eines kann ich nach wie vor damit verbinden: sich der Aufklärung verpflichtet wissen. Damit wäre "linke" Pädagogik eine, die "gegen" etwas steht, gegen ideologische Verklärungen, gegen vorkritische Wertaxiomatiken, gegen kollektive Regressionen. Und "für" uneingeschränkte Kritik, auch im Selbstbezug. Die Selbstkritik der Aufklärung ist eine Radikalisierung der Aufklärung, nicht ihre Verabschiedung. Ich denke, das kann auch für die linke Pädagogikdiskussion gelten.