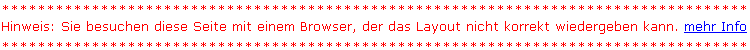Heft 41: Armut: kein Thema?
![]() 1991 |
Inhalt
| Editorial
| Leseprobe
1991 |
Inhalt
| Editorial
| Leseprobe

- Dezember 1991
- 100 Seiten
- EUR 7,00 / SFr 13,10
- ISBN 3-88534-087-9
Massenarbeitslosigkeit und nichts rührt sich
Über den Zusammenhang von Massenarbeitslosigkeit und politischem Protest
Auf einer Tagung des Wiener Alfred-Dallinger-Forums im Gemeindezentrum Gramatneusiedl hat Paul Neurath, Jahrgang 1911, im Frühjahr dieses Jahres über einen Klassiker der empirischen Sozialforschung referiert: die Marienthal-Studie (1933), deren berühmten Endbericht vor allem Marie Jahoda niedergeschrieben hat. Als "politisch interessantestes Ergebnis" bezeichnet Neurath in seinem Referat die Antwort auf eine Diskussion, die Anfang der 30er Jahre in allen Parteien Österreichs, und nicht nur dort, mit großer Emphase geführt wurde: "ob die massive Arbeitslosigkeit der Wirtschaftskrise die Arbeiter eher radikalisieren oder eher apathisch machen würde?"
Die Antwort war - die Neurath feststellt - "eindeutig": Die Arbeitslosen "wurden, sieht man von wenigen Ausnahmen ab, apathisch". Er selber erinnert sich, daß die radikalen Parteien nur wenige Arbeitslose erreichten: "Für das Gros der Arbeitslosen war wohl eher typisch, was die Marienthal Studie so deutlich zeigte: weitgehendes Zurückziehen in die eigene Schale, sich abkapseln von allem, was außerhalb der unmittelbar eigensten Sphäre vor sich geht." Er fügt hinzu: "Zu meinen Erinnerungen aus jener Zeit gehört, daß z.B. während der Wiener Februarkämpfe 1934 eine beträchtliche Anzahl von Arbeitslosen wie in jeder anderen Woche auf die Arbeitsämter stempeln gingen oder sich ihre Unterstützung abholten."
Die alte Hoffnung (oder Befürchtung), daß ökonomische Destabilisierung und politische Radikalisierung der von Wirtschaftskrisen Betroffenen zusammengehen würden, diese ursprünglich verelendungstheoretisch inspirierte These, gehört offenbar zu den nicht umzubringenden Erwartungen in jeder Rezession. Die aus heutiger Sicht bescheidene Arbeitslosigkeit Mitte der 70er Jahre sollte - wer sich erinnert - nach verbreiteter Auffassung Wasser auf die Mühlen systemkritischer Parteien leiten oder gar zur Formierung einer Arbeitslosenbewegung führen. Auf Soziologenkongressen wurde darüber debattiert, wieviel Prozentpunkte Arbeitslosigkeit eine Legitimationskrise des kapitalistischen Systems auslösen und zur politischen Destabilisierung führen würde. Ich selber erinnere mich noch an Diskussionen über die Funktion von Arbeitslosenzentren als vermeintlichen Transmissionsriemen einer breiten Arbeitslosenbewegung, die die kapitalistische Gesellschaft erschüttern werde.
Man sagt, das Enttäuschung die Aufhebung von Täuschung sei und damit Aufklärung. Verständlich - i.S. eines wishful thinking - sind solche Hoffnungen, daß soziale Ungerechtigkeiten Empörung und Widerstand hervorrufen, ja allemal. Und berichtete nicht Maria Jahoda über das Elend der Arbeitslosen in den dreißiger Jahren, daß die Kinder im Winter 1932/33 manchmal nur deswegen nicht nur Schule geschickt werden konnten, weil sie keine Schuhe besaßen, daß manche Familien Katzen und Hunde schlachteten, um nicht zu verhungern? Hans Zeisel, der an der Untersuchung gleichfalls beteiligt war, bezeichnete - möglicherweise mit mehr Recht als die traditionelle Lesart - die Marienthal-Studie vor allem als einen Beitrag zur Armutsforschung. Diese Einschätzung, die die Zeitgebundenheit der damaligen Befunde dokumentiert, ließ in den 70er Jahren die Hoffnung berechtigt erscheinen, daß unter veränderten, sprich: verbesserten sozialpolitischen Bedingungen 'alles anders sei', zumal sich - historisch und aktuell - in anderen Ländern ja immer auch wieder Beispiele für eine Auflehnung gegen die zugemutete soziale Lage der Arbeitslosigkeit und sozialen Ausgrenzung finden lassen.
New Deal als Reaktion auf Massenarbeitslosigkeit und damit verbundenen Unruhen in Amerika
Gemessen an der geringen gesellschaftlichen Bedeutung linker politischer Parteien und Gruppierungen und der Dominanz einer individualistischen Leistungsethik scheint - im Vergleich zu den europäischen Ländern - die Militanz und Auseinandersetzungsbereitschaft der Arbeitslosen in den 30er Jahren im Stammland des Kapitalismus, in den USA, noch am größten gewesen zu sein: Rückblickend auf die Zeit vor der Rooseveltschen New Deal-Politik urteilen Piven und Cloward: "Hätte es keine Arbeitsbeschaffung zur Befriedung der Bevölkerung gegeben, ist es schwer (selbst in der Rückschau) zu sagen, ob nicht die ausbrechenden Unruhen die wirtschaftlichen und politischen Institutionen des Landes in Gefahr gebracht hätten." Am 6.3.1930 - der sechste März war zum Internationalen Arbeitslosentag ausgerufen worden - beteiligten sich landesweit eine Million Amerikaner an den Aufmärschen und Demonstrationen. In vielen Städten, so auch in New York und Seattle kam es zu blutigen Straßenschlachten mit Toten und Verletzten. Die offene, überregionale, direkte Auseinandersetzung mit den Instanzen staatlicher Gewalt blieb jedoch in den USA wie in den Ländern Europas die Ausnahme.
Die amerikanische Arbeitslosenbewegung, der zumindest zeitweilig eine massenhafte Mobilisierung gelang, nahm - wie ein Historiker später schrieb - sehr bald den Weg vom "Aufruhr zur Respektabilität": Um als Verhandlungspartner politisch Einfluß zu nehmen, baute man eine nationale Organisation auf, die jedoch nach wenigen Jahren an ihrer Einflußlosigkeit zerbrach.
Das Dilemma, dem sich jeder Versuch der Politisierung und längerfristigen Organisation von Arbeitslosen gegenübersieht, hat m.E. Rosenzweig in ironischer Distanz am klarsten charakterisiert: "Die amerikanischen Radikalen hatten ihre Schwierigkeiten, sich auf die von den Arbeitslosen dauernd vorgebrachten Nöte einzulassen, statt diese Probleme als Konsequenz der inneren Widersprüche des Kapitalismus zu betrachten, die nur durch eine Revolution aufzuheben seien... Um diese Revolution zu bewerkstelligen, die sie als unerläßlich ansahen, mußten sie die Millionen von Arbeitslosen jedoch interessieren und ihre Unterstützung gewinnen. Dieser Versuch, eine Massenbasis unter den Arbeitslosen zu gewinnen, führte aber unweigerlich dazu, daß revolutionäre mit nichtrevolutionären Forderungen befaßt wurden. Entsprechend sahen sie sich einem verwirrenden Dilemma gegenüber: Sollten sie sich auf die unmittelbaren Bedürfnisse der arbeitslosen Arbeiter nach Unterstützung, Beschäftigung und Nahrung einstellen, oder sollten sie sich darauf konzentrieren, durch eine sozialistische Revolution die Arbeitslosigkeit selbst auf Dauer zu beseitigen? Im ersten Falle würde man vielleicht die Unterstützung der Massen gewinnen, aber keine Revolution, wahrend man im zweiten Falle vielleicht beide Ziele verfehlen würde."
Dabei ist, und das macht dieser Kommentar auch deutlich, für die 20er und 30er Jahre noch davon auszugehen, daß mit dem noch jungen Sieg des Kommunismus in der UdSSR eine realistische Systemalternative zu bestehen schien. Das Entstehen sozialer Bewegungen wird ja nie allein durch äußere Notlagen angestoßen, sondern ist immer und vor allem Ausdruck der Hoffnung auf eine mögliche Veränderung. Wie die Aufstände in den Elendsvierteln der englischen Städte regelmäßig vor Augen führen, führt Verzweiflung in die Revolte, die kurz aufflackert und ebenso schnell wieder verlöscht.
Aber bereits in den USA der 30er Jahre urteilte einer der Theoretiker der Sozialistischen Partei später ernüchtert und ernüchternd: die Kommunistische Partei schien "Oberwasser zu haben. Aber ihr Erfolg war eine Illusion. Im tiefsten Grunde interessierte sich der arbeitslose Arbeiter nicht für den Kommunismus. Er interessierte sich nur für eins: einen Job. Die KP konnte ihn in Demonstrationen hineinziehen; aber sie konnte ihm keine Arbeit verschaffen. Es war das New Deal, das das dann fertigbrachte - wenigstens für ein paar Millionen.
Massenarbeitslosigkeit - ein massenhaft individuelles Schicksal
Nun ist zwar in ökonomischen Krisenzeiten - heute müßte man wohl treffender sagen: in Zeiten einer Beschäftigungskrise bei gleichzeitig prosperierender Wirtschaft - Arbeitslosigkeit ein massenhaftes Schicksal, aber ein massenhaft individuelles. Es sind Einzelne, die arbeitslos werden; und die Ungleichartigkeit ihrer bisherigen Biographie und Lebenslage geht mit der Entlassung nicht verloren, wie jede Teilnahme an überregionalen Treffen von Arbeitslosengruppen nachdrücklich vor Augen führt. Zwar kommt es hin und wieder zu Massenentlassungen aus einem Betrieb, und dann ist bekanntermaßen am ehesten noch Widerstand zu erwarten. Aber allgemein führen - wie schon Neurath und die Marienthaler Forschungsgruppe bemerkte - Krisenlagen eher zu einem Sichzurückziehen auf den persönlichen Bereich und die persönlichen Möglichkeiten.
Im Falle der Arbeitslosigkeit kommt noch hinzu, daß es sich im Unterschied zu einer Vielzahl anderer Lebenssituationen, um ein potentiell vorübergehendes Ereignis, nicht von vorneherein um ein Dauerschicksal handelt. Lebensperspektivisch orientieren sich zumindest die kurzfristig Arbeitslosen daher weitgehend an den Beschäftigten und am regulären Arbeitsmarkt. Arbeitslosigkeit ist für sie der Übergang auf einen neuen Arbeitsplatz, oder doch zumindest die Hoffnung auf eine solche Auflösung der Arbeitslosensituation. - Warum sollten sie als Arbeitslose handeln wollen, zumal zeitweilige Arbeitslosigkeit ganz willkommen sein kann?
Je länger arbeitslos, desto weniger Gegenwehr
Und die langfristig Arbeislosen? Hier sammeln sich diejenigen, die aus Sicht der Arbeitgeber als wenig leistungsfähig erscheinen oder anderweitig Probleme bereiten könnten. Für sie hat der Sozialstaat "exits" bereitgestellt - als Frührentnerlnnen, Umschülerinnen, Hausfrau/-mann oder was auch immer. Sie verzweifeln möglicherweise an der Ausweglosigkeit ihrer Lage, sind verbittert und haben die Hoffnung auf Veränderung aufgegeben. Damit bilden sie erst recht kein Potential für eine Protestbewegung. Psychologisch gesprochen haben sie ein Hilflosigkeits- oder Demoralisierungstraining mit allen bekannten Folgen hinter sich: Passivität, kognitive Einschränkung der Aufmerksamkeit, Ängstlichkeit und gedrückte Stimmung.
Auffällig ist zudem, daß nach neueren Wahrnehmungen von Sozialarbeitern bei ihrem, vor allem jüngeren Klientel "der Wille zur Arbeit" fehlen soll, Arbeit verweigert wird und - so eine These im "Sozialmagazin" aus diesem Jahr - das Erscheinungsbild der Langzeitarbeitslosen sich immer mehr dem anderer sozialer Randgruppen (nach § 72 BSHG) annähert. Die politische Forderung, Arbeitslose als Arbeitsfähige und Arbeitswillige und auf diese Weise als Bestandteil des Arbeitsmarktes anzusehen, wird damit als unrealistisch infrage gestellt: "Ist das Problem der Langzeitarbeitslosigkeit überhaupt noch mit klassischen arbeitsmarktpolitischen Instrumenten zu lösen oder sind Dauerarbeitslose nicht schon längst ein Fall staatlicher Sozial-Fürsorge?" Und: ,,...der Schlüssel zur Beseitigung des Langzeitarbeitslosenproblems scheint nicht mehr in der Gesellschaft, sondern in der langzeitarbeitslosen Person selbst zu liegen" (Schultz). Die alte sozialistische Weisheit, daß Personen nur Symptome ihrer Verhältnisse seien und auf diese rückverweisen, ist offenkundig verloren gegangen oder nicht mehr gültig.
Und die Beschäftigten? Barrieren einer Solidarisierung
Nach Beobachtungen von Sozialpsychologen gibt es den offenbar tiefsitzenden Wunsch, an eine Welt zu glauben, in der es fair und gerecht zugeht. Dieser Wunsch hängt mit dem Bedürfnis zusammen, in einer Welt leben zu wollen, die nach verständlichen Regeln und damit durchschaubar funktioniert. Eine solche Welt wäre vertraut; in ihr könnte man sich sicher bewegen und realitätstüchtig handeln. Das Streben nach sozialer Gleichheit, zumindest nach Chancengleichheit, hat in diesem Glauben sicherlich eine starke Wurzel. Das psychologische Funktionieren dieser Überzeugung hat jedoch zwei Seiten: Kann sie mich einerseits mit meinem Schicksal versöhnen, da ich bekomme, was mir zusteht, so lautet der Umkehrschluß: Jeder andere erhält gleichfalls, was ihm zusteht.
Eine Möglichkeit, mit sozialer Ungleichheit umzugehen, nämlich sich für die Durchsetzung von Gleichheit einzusetzen und soziale Ungerechtigkeiten zu bekämpfen, ist aus individueller Sicht häufig jedoch zu aufwendig oder unpraktikabel. Nach einer Spiegelumfrage aus dem Jahre 1987 hielt z.B. nur noch jeder Dritte der repräsentativ befragten in Westdeutschland das Problem der Arbeitslosigkeit für lösbar (Spiegel, Nr. 4, 1987, S. 64). Viel bequemer und entlastender ist es jedoch, die Unähnlichkeit der Betroffenen herauszustellen und sie somit aus dem Geltungsbereich der Gesetze einer gerechten Welt auszugrenzen. Das einfachste Modell ist natürlich die Zuschreibung unvorteilhafter Persönlichkeitseigenschaften, die nach dem Motto - "Jeder bekommt, was er verdient" - ein Schicksal als verdient und soziale Ungleichheit als legitim erscheinen lassen. Das ist der klassische Vorurteilsmechanismus (1). Und im Sinne der These vom Körnchen Wahrheit in jedem Vorurteil bietet der reale Selektionsprozeß auf dem Arbeitsmarkt, der gering Qualifizierte, Ältere, Kranke, Labile usf. in die Chancenlosigkeit abdrängt, natürlich hervorragende Anknüpfungspunkte zur eigenen Entlastung: Da ich gesund, qualifiziert usf. bin, stellt Arbeitslosigkeit für mich keine Bedrohung dar. Und denkt man an die vielen Übersiedler aus dem Land des gescheiterten Realsozialismus, die sich hier - an der Schlange der westdeutschen Langzeitarbeitslosen vorbei - weitgehend reibungslos in das Beschäftigungssystem integrieren konnten, ist das empirisch ja auch nicht falsch. Und die erwähnten Einschätzungen aus der Sozialarbeiterszene lassen ja drastisch deutlich werden, daß von Teilgruppen der Arbeitslosen (Lohn-)Arbeit im gesellschaftlich normalen Sinne nicht mehr gewollt wird. Sie bewegen sich mit teilweise bewundernswerter Kundigkeit und Raffinesse in einer Zwischenzone gesellschaftlicher Existenz, die abzuschaffen sie selbst am wenigsten Interessen haben können. Die empirische Arbeitslosenforschung kann ja seit langem belegen, daß eine kleine Gruppe sogenannter "good copers", der guten Bewältiger, mit der Situation der Erwerbslosigkeit psychisch durchaus fertig wird. Eine Untersuchung aus dem letzten Jahr schätzt den Anteil auf ein Fünftel aller Arbeitslosen. Es überwiegen Personen mit einem qualifizierten Bildungs- und/oder Berufsabschluß, die finanziell noch einigermaßen über die Runde kommen und hohe Erwartungen an ihre potentielle Berufstätigkeit haben. Im Vergleich zur Gruppe mit ausgeprägten Identitätsproblemen (rund 30 %), die zu 80 % klagen, die freie Zeit mache ihnen zu schaffen, berichtet nur ein knappes Drittel (29 %) der guten Bewältiger über entsprechende Belastungen durch die Arbeitslosigkeit.
Was bleibt also von der Hoffnung auf eine Arbeitslosenbewegung: Wohl die Gültigkeit der Einsicht, die Piven/ Cloward in ihrer großen Untersuchung über die Geschichte der Armuts- und Sozialbewegungen schon vor mehr als einem Jahrzehnt formulierten: "Sharp inequality has been constant, but rebellion infrequent". That's it.
Anmerkung
1. Er zielt übrigens - in dieser Hinsicht sind Umfrageergebnisse, die eine geminderte Vorurteilsbereilschaft gegenüber Arbeitslosen belegen, irreführend - weniger auf die Ursachen des Eintretens von Arbeitslosigkeit, sondern viel stärker auf die Frage, warum jemand nicht wieder Arbeit findet, also langzeitarbeitslos bleibt.