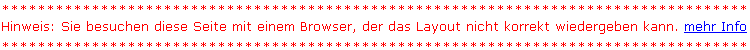Heft 71: Biologisierung des Sozialen
![]() 1999 |
Inhalt
| Editorial
| Leseprobe
1999 |
Inhalt
| Editorial
| Leseprobe
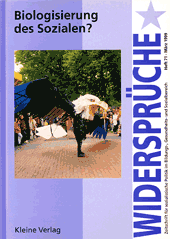
- März 1999
- 112 Seiten
- EUR 11,00 / SFr 19,80
- ISBN 3-89370-302-0
Zu diesem Heft
Wo Gesellschaft schwierig wird, muß Natur her: So lautet der Verdacht, der die Diskussionen in der WIDERSPRÜCHE-Redaktion zur Rolle biologischer Argumentationen in gesellschaftspolitischen Zusammenhängen stets weitgehend dominierte. Warum haben wir unseren Schwerpunkttitel, die Biologisierung des Sozialen, dennoch mit einem Fragezeichen versehen?
Als 1975 Edward O. Wilsons Buch Sociobiology: The New Synthesis erschien, in dem dieser erklärte, die von ihm begründete Soziobiologie sei zu verstehen als "die systematische Erforschung der biologischen Grundlagen jeglicher Formen des Sozialverhaltens bei allen Arten sozialer Organismen einschließlich des Menschen", schienen die Fronten klar zu sein: SozialwissenschaftlerInnen konstatierten einen unangemessenen Erkenntnisanspruch und eine unzulässige Ausdehnung evolutionstheoretisch orientierten Vokabulars auf ihren Gegenstandsbereich. Die Widersprüche, die sich schnell ergaben, wenn man versuchte, Wilsons Behauptung, sämtliches soziale Verhalten sei mit dem unbedingten Ziel jeden Organismus', seine genetische Fitneß zu maximieren, sprich: die Zahl seiner Nachkommen so hoch wie möglich zu schrauben, an konkreten Beispielen durchzuspielen bzw. zu überprüfen, sprachen schließlich eine eindeutige Sprache. Diese Kritik verfehlte jedoch offensichtlich ihre Adressaten - oder wurde aus den Reihen der Apologeten der Soziobiologie als Ausdruck der narzistischen Kränkung darob verspöttelt, einerseits des originär eigenen Gegenstandsbereichs und andererseits des Status' als Exemplar der Gattung 'Krone der Schöpfung' verlustig gegangen zu sein (vgl. Sommer 1992). Jedenfalls setzte Richard Dawkins 1976 mit seinem Buch Das egoistische Gen noch eins drauf: Bei ihm kamen Menschen erst gar nicht mehr als Handlungssubjekte, sondern nur noch als Träger bzw. Vehikel ehrgeiziger Gene vor, welche ihre ganz eigenen Ziele verfolgen und damit dafür sorgen, daß die Evolution ihren Gang geht. Im Laufe der zwei darauffolgenden Jahrzehnte machten sich Dawkins und Wilson daran, ihr doch recht einfaches Entwicklungsmodell als wissenschaftlich gültige Erklärungsgrundlage auf weitere Bereiche auszuweiten. Nachdem die Entwicklung und das Verhalten der Organismen ja nun zufriedenstellend durch die Existenz und das Wirken der Gene - kleine, die für die individuelle Entwicklung notwendigen Informationen enthaltende Einheiten - erklärt war, wurden nun die Meme ersonnen: Diese agieren in den Genen analoger Weise, aber überindividuell, um die kulturelle Entwicklung von Gesellschaften zu begründen. Seltsamerweise blieb diesmal, anders als Mitte der siebziger Jahre, der empörte Aufschrei der KulturwissenschaftlerInnen aus. Im Gegenteil: Die Organisatoren der Ars Electronica widmeten dem Mem-Konzept 1996 sogar ihren thematischen Schwerpunkt. 1998 erschien schließlich Wilsons neues Buch Die Einheit des Wissens: eine Einheit, die selbstverständlich auf Wilsons soziobiologischen Einsichten basiert, und ein Buch, das hauptsächlich für Vertrauen in 'die Wissenschaft', und das heißt laut Wilson: jeglicher Ideologie - und daran kann auch die Danksagung an Newt Gingrich im Anhang des Buches nichts ändern - unverdächtige Naturwissenschaft und ihre technologischen Produkte werben will. Der geringe Seriositätsgehalt dieser um Vertrauen werbenden Wissenschaft kann mit einer genauen Untersuchung ihrer Methoden und ihrer Verallgemeinerungen 'entlarvt' werden - vielfach schon ist gezeigt worden, daß die Soziobiologie durchaus etliche Kriterien von bad science erfüllt (vgl. bspw. Fausto-Sterling 1988; Hemminger 1994). Daß dieser Tatbestand ihrer Popularität nach wie vor keinen Abbruch tun konnte - so ist in der Frankfurter Rundschau vom 2. Januar 1999 eine Rezension der Einheit des Wissens abgedruckt, die von keinem Hauch von Kritik getrübt ist -, stimmt skeptisch. Denn immerhin, und das ist für unsere Diskussion der eigentliche Knackpunkt, wird nicht nur individuell menschliches Verhalten, sondern werden auch soziale (Ungleichheits-)Verhältnisse hier zweckdienlich kategorisiert und auf biologisches Schicksal zurückgeführt. So werden bspw. die bürgerlichen Geschlechterrollen nicht als Produkt bestimmter gesellschaftlicher Machtverhältnisse verstanden, sondern aus 'Notwendigkeiten' der biologischen Fortpflanzung bzw. der maximalen Genweitergabe abgeleitet. Solche Naturalisierungen gesellschaftlicher Strukturen wirken legitimierend bzw. machen Legitimation schlichtweg überflüssig, da sowieso keine Alternativen denkbar sind.
Aber nicht nur in dieser Weise determinieren die Gene die Schicksale der Menschen. Die Genforschung trägt inzwischen mit immer neuen 'Funden' dazu bei, gesellschaftlich hervorgebrachte Ungleichheit zu legitimieren: Inzwischen gibt es kaum noch eine Normabweichung, die nicht auf 'ihr' Gen zurückgeführt wird. Nicht nur die Neigung zu einer ganzen Reihe von Krankheiten, die Neigung zu Homosexualität oder die Neigung zu Fettleibigkeit, auch die Neigung zu Straffälligkeit oder Gewalttätigkeit sind demzufolge biologisches Schicksal. Absurderweise haben bspw. Schwulenverbände in den USA teilweise positiv auf solche Genfund-Nachrichten reagiert: Sie empfanden es als entlastend, jetzt nicht mehr als 'schuldig', sondern nur noch als 'krank' zu gelten. Solche Reaktionen der von der Genforschung als Träger von Genen unterschiedlicher Güte kategorisierten und klassifizierten Menschen machen darüber hinaus deutlich, daß die Zuschreibungen, die per Genträgerschaft an Gruppen von Menschen vorgenommen werden, von den einzelnen nicht unbedingt einfach zurückgewiesen werden können, sondern häufig - und hier zeigt sich das Vorhandensein des von Wilson erheischten Vertrauens in 'die Wissenschaft' - in die Wahrnehmung von sich selbst übernommen werden, sei es als Entlastung von eigener 'Schuld' daran, so zu sein, wie man ist, sei es als Makel, dem man sich stellen, bzw. Unglück, auf das man vorbereitet sein muß (bspw. bisher nicht erkrankte TrägerInnen von 'Krankheitsgenen').
Entsprechend wird von seiten der Genforschung gegen Kritik gerne eingewandt, man sei mit ihren Ergebnissen doch einfach besser vorbereitet: Potentielle Gewalttäter können überwacht oder weggesperrt werden, potentiell Dicke kriegen schon in jungen Jahren Diät, Krankheitsgefährdete können sich gesunde Lebensgewohnheiten aneignen und pränatale Diagnostik eröffnet die Möglichkeit, pränatal oder postnatal schnell die geeigneten Maßnahmen zu ergreifen. Hier folgen allerdings zwei massive Probleme direkt auf dem Fuß. Wie kann man erstens angemessene Maßnahmen ergreifen, wenn man berücksichtigt, daß das Vorhandensein eines bestimmten Gens in der Gesamtheit der Erbanlagen des Individuums nichts darüber aussagt, ob das diesem Gen zugeordnete Merkmal konkret zur phänotypischen Ausprägung gelangen wird oder nicht? Mit anderen Worten: Wie können verantwortliche Kriterien für ein Handeln aussehen, daß sich auf Wahrscheinlichkeiten bezieht? Zweitens wird sich bei Gegebenheit entsprechender Möglichkeiten - nicht nur bei den Krankenkassen - schnell die Einsicht durchsetzen, daß Vorbeugen bzw. Vermeiden einfacher und billiger ist als Reparieren, so daß über kurz oder lang der Weg zur 'eugenischen' Selektion praktisch unvermeidlich ist.
Warum sollten kritische SozialwissenschaftlerInnen vor dem Hintergrund dieser Überlegungen die Biologisierung des Sozialen dennoch mit einem Fragezeichen versehen? Darauf haben wir zwei miteinander verschränkte Antworten, die unsere Auseinandersetzung mit der Thematik wohl auch im weiteren prägen werden und die man am Beispiel der Soziobiologie deutlich explizieren kann.
Erstens: Wissenschaft - auch und vor allem biologische und medizinische - ist trotz aller Beteuerungen nie 'ideologiefrei', sondern ein Produkt gesellschaftlicher Praktiken, von Menschen ausgeübt. Wenn also die Rede von der Biologisierung des Sozialen die Einschätzung zum Ausdruck bringt, daß Forscher objektive Erkenntnisse aus der Natur auf gesellschaftliche Zusammenhänge übertragen, greift sie zu kurz, indem sie erst jene Übertragung problematisiert, nicht aber die Einschätzung, 'Natur' könne objektiv erfaßt werden. Zum Beispiel wird hingegen an Wilsons Soziobiologie sehr deutlich, daß hier ein weißes, bürgerliches, männliches, heterosexuelles US-Individuum das einzige Geschlechterrollenmodell, das er kennt und das ihm denkbar ist, auf seine 'Naturbeobachtungen' (Wilson begann seine Karriere ursprünglich als Ameisenforscher) übertragen hat. Die 'Biologie', die Wilson nun auf gesellschaftliche Zusammenhänge übertragen will, ist also keine 'reine', ideologiefreie Naturwissenschaft, sondern ein Ensemble von disziplinär geformten Interaktionen mit seinem Beobachtungsgegenstand (den Ameisen), das in soziale Vorstellungen und Praktiken eingelassen ist, die die Lebenswelt des Forschers prägen. Für die Biologisierung des Sozialen heißt das: Die ihr zugrundeliegende kategoriale Trennung des 'Biologischen' und des 'Sozialen' ist eine artifizelle; Menschen und ihre Praktiken und Produkte sind immer schon in beiden Sphären gleichzeitig verankert.
Zweitens: Beschränkt man als SozialwissenschaftlerIn die Kritik an den unterschiedlichen Biologisierungen des Sozialen darauf, daß hier ein nicht statthafter Eingriff in den eigenen angestammten Forschungsbereich vorgenommen wird, dann muß man sich auch gefallen lassen, daß einem - wie von einigen Soziobiologen in Reaktion auf sozialwissenschaftliche Kritik an ihrem Vorgehen vorgeführt - unterstellt wird, man zeige lediglich die Symptome einer narzistischen Kränkung aufgrund des Hegemonieverlusts auf dem eigenen Spielfeld. Ernstzunehmende Kritik an naturwissenschaftlich-technischen Entwicklungen muß sich schon die Mühe machen, sich mit diesen auseinanderzusetzen, anstatt einfach die Revierhoheit für sich zu reklamieren.
Will man von seiten der kritischen Sozialwissenschaften den Sachzwangscharakter biologisch-medizinischer Modelle und Technologien in Frage stellen und ihre Entwicklung zugunsten der Menschen beeinflussen, ist es notwendig, die entsprechenden Forschungen als gesellschaftliche Praktiken und auf ihre sozialen Vorraussetzungen, Hintergründe, Implikationen und Folgen hin zu untersuchen. Hier könnte praktizierte Interdisziplinarität, bspw. in heterogen zusammengesetzten Forschungsprojekten, von großem Nutzen sein. Nur so wird es möglich sein, Alternativen und Spielräume aufzuzeigen und mit dazu beizutragen, daß sich der gesellschaftliche Prozeß der Wissenschafts- und Technologieentwicklung mit all seinen Konsequenzen 'sozialverträglich' gestaltet.
Zu den Beiträgen im einzelnen
Sabine Schleiermacher zeichnet in ihrem Beitrag die Entwicklung der unseligen Verquickung gesellschaftspolitischer Begehrlichkeiten mit biologischen und medizinischen Wissenschaften seit dem 19. Jahrhundert in Deutschland nach. Schon seit ihrem Beginn waren gesellschaftliche Bezugnahmen auf entsprechende 'Forschungsergebnisse' hauptsächlich bevölkerungspolitisch motiviert; und umgekehrt brachte das gesellschaftspolitische Klima schnell entsprechende Forschungsfragestellungen in den Vordergrund: Den 'Rassenhygienikern' ging es darum, den 'Volkskörper' möglichst 'gesund' zu erhalten und Krankheit und Abweichung, kurz: unnützes Leben auszumerzen oder, noch besser, seine Entstehung - im wahrsten Sinne des Wortes - gleich im Keim zu ersticken. Insofern kann die Autorin zeigen, daß der Boden für die 'eugenischen' Exzesse des Nationalsozialismus längst bereitet war: Die "Lösung der 'sozialen Frage'" hatte den Weg zur 'Endlösung' geebnet.
Mit demselben Bereich biomedizinischer Forschung befaßt sich Michael Wunder in seinem Beitrag. Sein Blick richtet sich jedoch auf Gegenwart und Zukunft der 'Eugenik'. Wunder ordnet bereits praktizierte sowie im Forschungs- und Erprobungsstadium befindliche Technologien der genetischen Optimierung des Menschen in einem "Eskalationsmodell" an und unterzieht die einzelnen Stufen desselben einer kurzen ethischen und rechtlichen Bewertung. Dabei konstatiert er einerseits einen sich abzeichnenden Schwenk von der 'negativen' zur 'positiven' Eugenik, d.h. von Techniken des genetischen Screenings im Sinne der Krankheitsvermeidung hin zu einer Züchtung des Gewünschten, und andererseits eine stetig wachsende Eingriffstiefe: Von Manipulationen der Fortpflanzung sind nicht mehr 'nur' einzelne Individuen betroffen, sondern - in unabsehbarer Art und Weise - auch ihre Nachkommen. Versuche des Europarates und der UNESCO, die entsprechenden Technologien zu regulieren und zu kontrollieren, kritisiert der Autor als nicht hinreichend.
Während die ersten beiden Beiträge die Frage nach einer Biologisierung des Sozialen ohne Einschränkung bejahen, nähert sich ihr Winfried Manke in seinem Beitrag über Geschichte und Gegenwart der Hochbegabungsförderung aus einer ganz anderen Perspektive. Schon im 19., nochmals verstärkt aber im 20. Jahrhundert ist die Debatte um die Entstehung von 'Begabung' und 'Intelligenz' durch ein Pendeln zwischen den beiden Polen 'Anlage' vs. 'Umwelt' bzw. 'angeboren' vs. 'anerzogen' charakterisiert. Für die Zeit seit den sechziger Jahren dieses Jahrhunderts sieht Manke die Debatte in der BRD bei einer alleinigen Orientierung am 'Umwelt'-Paradigma angelangt; dieser "Sozialisierung des Biologischen", der er die Ablehnung spezifischer Förderung für Hochbegabte als 'elitär' zur Last legt, hält der Autor das Anliegen entgegen, man möge eine Postition jenseits der dichotomen Konstruktion von 'Anlage' und 'Umwelt' einnehmen, die die Existenz unterschiedlicher Begabungen einräumt und damit deren jeweils spezifische Förderung ermöglicht.
Der Beitrag von Michael May befaßt sich schließlich mit der Frage der Übertragbarkeit von Begriffen und (System-)Modellen aus den modernen Naturwissenschaften auf sozialwissenschaftliche Gegenstandsbereiche, konkret Begriffe naturwissenschaftlicher Selbstorganisationstheorien auf die Theoretisierung der (Re-)Produktion des Selbst im Spannungsfeld von Autonomie und Gesellschaftlichkeit. Der Autor deckt theoretische Schwachstellen und Inkonsistenzen auf, die nicht nur Luhmann, sondern auch andere Sozialwissenschaftler sich fast zwangsläufig einhandeln, wenn sie systemtheoretische Modelle - teilweise unter Vernachlässigung klarer Aussagen von deren Urhebern bzgl. ihres zulässigen Geltungsbereichs - auf gesellschaftstheoretische Gegenstandsbereiche übertragen. Unter Rückgriff auf Hegels Dialektik der Anerkennung schlägt May mit Negt/Kluge schließlich für die Weiterarbeit das Konzept der Selbstregulierung vor.
Die Redaktion
Literatur
- Dawkins, Richard 1978 [1976]: Das egoistische Gen. Berlin, Heidelberg, New York
- Fausto-Sterling, Anne 1988 [1985]: Gefangene des Geschlechts? Was biologische Theorien über Mann und Frau sagen. München
- Hemminger, Hansjörg 1994: Soziobiologie des Menschen - Wissenschaft oder Ideologie? In: Spektrum der Wissenschaft, Juni, S. 72-80
- Heilmeier, Josef; Mangold, Klaus; Marvakis, Athansios; Pfister, Thomas (Hg.) 1991: Gen-Ideologie. Biologie und Biologismus in den Sozialwissenschaften. Argument-Sonderband 175. Hamburg, Berlin
- Sommer, Volker 1992: Soziobiologie: Wissenschaftliche Innovation oder ideologischer Anachronismus? In: Eckart Voland (Hg.): Fortpflanzung: Natur und Kultur im Wechselspiel. Versuch eines Dialogs zwischen Biologen und Sozialwissenschaftlern. Frankfurt/Main, S. 51-73
- Wilson, Edward O. 1975: Sociobiology: The New Synthesis. Harvard University Press, Cambridge/MA
- Wilson, Edward O. 1998: Die Einheit des Wissens. Berlin