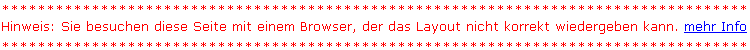Heft 157: Gesellschaftliche Institution(en) - Kritik und Perspektive der Institutionalisierung von Bildung und Sozialem
![]() 2020 |
Inhalt
| Editorial
| Abstracts
| Leseprobe
2020 |
Inhalt
| Editorial
| Abstracts
| Leseprobe
Zu diesem Heft
Die Etablierung gesellschaftlicher Institutionen ist Bedingung und Dilemma der "bürgerlichen Welt" (Heydorn 1980, S. 285) zugleich. Sei es die moderne Universität, die Regelschule oder die (quasi-)staatlichen Einrichtungen für Hilfe und Erziehung - sie alle sind Ausdruck des Anspruchs, die Bedingungen der Möglichkeit von Mensch-Sein im sozialen Kontext mit anderen allgemein zu gewährleisten. Aus der Perspektive einer materialistischen Gesellschaftstheorie lässt sich bereits dieser Anspruch als Verblendungszusammenhang dechiffrieren: Marxistisch lässt sich von gesellschaftlichen Institutionen vor allem in Bezug auf den Staat sprechen, der so die Überzeugung insbesondere ideologietheoretischer Lesarten, keinen Ort wirklicher politischer Auseinandersetzungen darstellen kann. Als Instanz der Sicherung bestehender Herrschaftsverhältnisse können die existierenden gesellschaftlichen Institutionen nurmehr Vorbedingung einer zukünftigen revolutionären Dynamik hin zu anderen, alternativen Institutionen sein. Allerdings weist die Marxsche Analyse an dieser Stelle eine deutliche Leerstelle auf: Die Frage, wie gesellschaftliche Transformationsbewegungen zu einer solchen alternativen institutionellen Konstellation führen können, bleibt in den Arbeiten von Marx selbst weitgehend unbeantwortet. Daher beschäftigt diese Frage gerade neomarxistische Autor:innen seit langem: Insbesondere die hegemonietheoretischen Arbeiten im Anschluss an Antonio Gramsci, sei es nun in der staatstheoretischen Tradition Poulantzas', den regulationstheoretischen Konzeptualiserungen Agliettas, Hirschs und Jessops oder in Form der Beträge zu einer materialistischen Kulturtheorie, wie sie vor allem mit dem Namen Hall verbunden sind, sind hier von einiger Bedeutung. Die Konzeption des erweiterten oder auch "integralen Staats", wie es Gramsci vorgeschlagen hat, verweist über die staatlichen Zwangsmöglichkeiten hinaus einerseits auf die Notwendigkeit der Herrschaftssicherung durch die Stabilisierung des vorherrschenden Denk- und Deutungsweisen (kulturelle Hegemonie); es öffnet andererseits den Blick auf das Potenzial "zivilgesellschaftlicher" Organisationen im erweiterten Staat, mit denen der Möglichkeit einer Implementierung und Dynamisierung alternativer Hegemonien als Vorbedingung gesellschaftlicher Transformationsprozesse ein Ort gegeben werden kann.
Die Skepsis gegenüber dem Potenzial gesellschaftlicher Institutionen lässt sich mit Adorno und Horkheimers (1944/1998) Aufklärungspessimismus, und dabei durchaus in Korrespondenz zu Max Webers Zeitdiagnose, nach den Jahren des Nationalsozialismus im 20. Jahrhundert allerdings - historisch wenige Jahre nach Gramscis Überlegungen formuliert - erneut aufrufen: Die Beherrschten werden, so die radikal negativistische Überzeugung von Adorno und Horkheimer, nurmehr zu "Objekten des bloßen Verwaltungswesens" (ebd., S. 45). Doch schließt man daraus auf eine Deutung gesellschaftlicher Institutionen kurz, bliebe eine solche Lesart eigenartig un-widersprüchlich, verfehlt sie doch die Einsicht in die potenziellen Möglichkeiten gesellschaftlicher Institutionen. Das lässt sich seit vielen Jahren aus den Einsichten des marxistischen Feminismus lernen, die uns vor allem gelehrt haben, dass kapitalistischen Produktionsverhältnisse eine entscheidende materielle und soziale Bedingung vorausgeht: die Herstellung der Bedingung für Lohnarbeit, d.h. die Entwicklung und Reproduktion des Arbeitsvermögen, einerseits in der privaten Konstellation der Familie, in der bis heute die Sorgearbeit mehrheitlich von Frauen erbracht wird, und andererseits in der öffentlichen Infrastruktur des Bildungs-, Sozial- und Gesundheitsbereiches. Diese beruht ebenfalls zu allergrößten Teilen auf weiblicher Arbeit. Der Blick in diese gesellschaftlichen Institutionen verdeutlicht wiederum, dass Institutionalisierung eine widersprüchliche Geschichte ist: Sorgearbeit ist Reproduktionsarbeit auch in dem Sinne, dass sie an der Reproduktion bestehender gesellschaftlicher Verhältnisse beteiligt ist. Zugleich sind es gerade die alltäglichen Konstellationen der Sorgearbeit, die ein Potenzial für Alternativen in sich tragen, denn der Alltag ist eben immer auch möglicher Ort für soziale Fantasie und für (gesellschaftliche) Veränderungsversuche. Der Alltag - in privaten wie öffentlichen Zusammenhängen - ist nicht schon die Alternative, aber kann Ansatzpunkte für die gesellschaftliche Transformation hervorbringen. Und Alltag findet sich eben sowohl in der zentralen gesellschaftlichen Institution, die primär im Privaten verortet ist: der Familie, als auch in öffentlich verfassten gesellschaftlichen Institutionen, wie der Sozialen Arbeit.
Dass gesellschaftliche Institutionen auch das Potenzial der Alternative beinhalten, hat historische Gründe: Gesellschaftliche Institutionen, wie die (sozial-)staatlichen Organisationen im Bildungs-, Sozial- und Gesundheitsbereich, stellen ein materialisiertes Resultat sozialer Auseinandersetzungen dar. Als solche ist die (private wie öffentliche) Institutionalisierung von Sorgearbeiten auch Ausdruck des Anspruchs auf die Gewährleistung sozialer Gleichheit und politischer Partizipation, der sich historisch-spezifisch - via (Bildungs-, Sozial-, ...-)Recht - in einer auf Dauer gestellten institutionellen Infrastruktur konkretisiert. Deshalb sind gesellschaftliche Institutionen eben auch nicht nur materialisierter Ausdruck faktischer Herrschaftsstrukturen, sondern immer auch das Resultat von (temporären) gesellschaftlichen Kompromissen. Zugleich ist mit ihrer historischen Etablierung im sozialstaatlichen, und damit immer auch im nationalstaatlichen Format historisch keine grundlegende gesellschaftliche Transformation vollzogen - eher ist das Gegenteil, die Stabilisierung klassenförmiger Verhältnisse, der Fall. Auch das lässt sich historisch zeigen, z.B. an der Rolle und Positionierung der Arbeiterbewegung im Kontext der Etablierung des deutschen Sozialversicherungswesens: Die Durchsetzung der ersten Sozialversicherungsgesetze geschah 'von oben' und war dabei aber gerade davon motiviert, die politische Position der Arbeiterbewegung durch den Ausbau eines Interventionsstaates zu schwächen: u.a. durch die Einbindung der Arbeiterorganisationen in das korporatistische Sozialstaatsgebilde. Alternative politische Gleichheitsforderungen, die z. B. die Logik des Privateigentums in Frage stellen wollten, sollten dagegen mit dem System der sozialstaatlichen Teilhabesicherung kaltgestellt werden. Zugleich war die Sozialgesetzgebung der 1880er Jahre eine Reaktion der Regierung Bismarck auf den politischen Druck der damaligen Arbeiterbewegung.
Gesellschaftliche Institutionen in ihrer bestehenden Form können als materialisierte Kompromisse verstanden werden, in denen sich daher die bestehenden gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse verdichten, aber auch widerspiegeln. Dieser Sachverhalt wird noch dadurch verstärkt, dass alle konkreten Institutionalisierungsformen von Beginn an, aufgrund ihres Eigen-Interesses an ihrer Selbsterhaltung und Verstetigung, von der Tendenz der Verallgemeinerung ihres jeweiligen Spezifikums geprägt sind: Die Universität tendiert zu Absolutierung wissenschaftlicher Rationalität, die Schule zur Scholarisierung von Kindheit und Jugend und die öffentliche Fürsorge zur Verallgemeinerung des Kinderschutzes. Insofern ist es auch nicht überraschend, dass die Institutionalisierung von Bildung und Sozialem, ähnlich wie auch die Institutionalisierung des kranken und abweichenden Körpers, historisch kontinuierlich von einer Kritik der Institutionalisierung und unterschiedlich erfolgreichen Versuchen der Deinstitutionalisierung begleitet werden - ja werden müssen, vergewissert man sich ihrer konstitutiven Widersprüchlichkeit. Diese finden ihren argumentativen Rückhalt häufig in gesellschafts- und herrschaftskritischen Positionen. So genannte Reformuniversitäten wie alternative Hochschulprojekte speisten sich nicht zuletzt aus der Kritik der parafeudalen "Ordinarienuniversität", reformpädagogische Schulprojekte aus der Kritik der Regelschule und gemeinwesenarbeiterische oder sozialraumbezogene Ansätze und Programme in der Sozialen Arbeit entstanden auf der Basis der Kritik der etablierten Fürsorgeerziehung. Kritik der Institutionen und Institutionalisierungskritik ist damit Gesellschafts-/Herrschaftskritik und weist auf eine wichtige Tendenz der Moderne, die dunkle Seite ihres Beitrags zur Zivilisierung sozialer Auseinandersetzungen hin. Foren und Orte der Gesellschafts- und Herrschaftskritik, zu deren Etablierung und Gestaltung auch die WIDERSPRÜCHE beizutragen versuchen, sind daher immer auf Ort der Institutionenkritik, gerade als Kritik gesellschaftlicher Institutionen.
Die Verkopplung von Gesellschafts- und Herrschaftskritik mit Institutionenkritik macht aber auch tendenziell übersehen, dass (1.) Deinstitutionalisierungsversuche zumeist zu neuen Institutionalisierungsprozessen führen, weshalb z.B. in der internationalen Deinstitutionalisierungsdiskussion in Bezug auf die Psychiatrie inzwischen von "Transinstitutionalisierung" gesprochen wird. Diesen alternativen und reformerischen Institutionalisierungsprozessen wird aufgrund ihrer Verwurzelung in gesellschafts- und herrschaftskritischen Deutungen oft zu wenig Bedeutung beigemessen; (2.) Institutionalisierungsversuche ein Konstitutivum für das Versprechen der modernen Gesellschaft sind, die Prinzipien von Freiheit und Gleichheit allgemein zu gewährleisten.
Die Aufforderung, die sich daher stellt, ist die einer kritischen Reflexion von Institutionalisierung - hier am Beispiel von Bildung und Sozialem, die diese Verkürzungen möglichst vermeidet, und daher die historische Gleichzeitigkeit von Institutionalisierung und Institutionalisierungskritik an konkreten Entwicklungen beleuchtet und problematisiert und zugleich die Perspektive für eine 'gesellschaftliche Institutionalisierung', wie sie zum Beispiel im Anschluss an die Überlegungen von Eric Olin Wright denkbar sind, konkretisiert. Wright formulierte im Kontext seines Projektes "Real Utopias" (siehe dazu die Rezension von Heinz Sünker in diesem Heft) die "Kernaufgabe emanzipatorischer Politik" als "Schaffung solcher Institutionen" (S. 46). Dabei versteht er Emanzipation als moralische Verpflichtung politischer Akteur:innen, "die Aufhebung von Unterdrückung und die Herstellung der Bedingungen menschlicher Entfaltung" zu befördern (S. 50). Ansatzpunkt für eine damit programmatisch bestimmte gesellschaftliche Transformation sind für Wright die konkreten Institutionen, die er bereits als "gesellschaftliche Institutionen" am Werke sieht, dies aber nicht im Sinne sozialer und politischer Gerechtigkeit tun. Sondern ganz im Gegenteil: Sie produzieren Leid und Ausschließung. Dass Wright hier an die Organisationen im Bildungs- und Sozialbereich denkt, Schulen, sozialpädagogische Einrichtungen auf der einen Seite und sozialstaatliche Grundsicherungssysteme auf der anderen Seite, liegt auf der Hand.
Eine alternative gesellschaftliche Institutionalisierung hätte sich immer auf das Allgemeine zu beziehen, und von dort aus der Dynamik des allen Institutionen immanenten Ziels der eigenen Selbsterhaltung zu widersetzen, was nur auf Basis ihrer radikalen Demokratisierung möglich sein wird. Zugleich kann damit keine Auflösung der rechtlichen Gewährleistung gemeint sein, die ein Konstitutivum einer freien und gleichen Gesellschaft darstellt. Insofern können 'gesellschaftliche Institutionen' auch immer nur Arenen für gesellschaftliche Konflikte darstellen.
Zu den Beiträgen im Einzelnen
Marion Ott geht in ihrem Beitrag der Praxis von Institutionalisierung am widersprüchlichen Konzept der 'Mitwirkung' im Feld der bundesdeutschen Kinder- und Jugendhilfe - insbesondere mit Blick auf die Etablierung der Kinderschutzpolitiken der vergangenen Jahre - nach. Dazu nimmt sie eine praxis- und institutionenanalytische Perspektive im Anschluss an die Arbeiten von Dorothy Smith ein. Ihre rekonstruktive Analyse basiert daher auch auf eigenen ethnographischen Forschungsarbeiten. Am Beispiel der Institutionalisierung von Mitwirkung im Rahmen der Hilfeplanung kann sie so nicht nur die systematische Verortung von Institutionalisierung beleuchten, sondern verdeutlichen, dass Mitwirkung auch einen Ort der systematischen Konflikteinhegung darstellt, an der Fachkräfte wie Nutzer:innen beteiligt sind.
Die Gleichzeitigkeit von Institutionalisierung und Deinstitutionalisierung beleuchtet Falko Müller in seinem Beitrag am Beispiel der palliativen Sterbebegleitung. Von den einen wird deren Erfolgsgeschichte als 'Entinstitutionalisierung' des Sterbens beschrieben, von anderen als verstärkte 'Institutionalisierung' des Sterbens. Diesen differenten Deutungen liegen auch unterschiedliche Begriffe des Institutionellen zugrunde, die vom Autor im ersten Teil des Beitrags reflektiert und kontextualisiert werden. Vor diesem Hintergrund diskutiert er im zweiten Teil die Widersprüchlichkeiten in der (De)Institutionalisierung der Praxis ambulanter Sterbebetreuung und hinsichtlich ihres Selbstanspruchs der Subjektorientierung.
Der Beitrag von Stephan Wolff widmet sich der Analyse des 'Wechselspiels' von De-Institutionalisierungs- und Institutionalisierungsprozessen vor dem Hintergrund der neo-institutionalistischen Organisationstheorie und untersucht diese Prozesse anhand der historischen Verläufe der Forderung nach Alternativen zu anstaltsförmigen Praxen der Unterbringung, Behandlung und Kontrolle im Bereich der Psychiatrie und der Behindertenhilfen, die als praktische Kritik De-Institutionalisierung auf Ihre Fahnen geschrieben hatten. Dabei werden insbesondere die Ambivalenzen der De-Institutionalisierung als auch das pfadabhängige Beharrungsvermögen von Organisationen gegen Versuche der De-Institutionalisierung herausgearbeitet.
Wie schwierig sich die politisch wirksame Thematisierung von Wohnungslosigkeit als gesellschaftliches Problem ohne starke organisationelle und institutionelle Strukturen durch die Betroffenen(gruppen) erweist, zeigt der Betrag von Stephan Nagel. Die Gründe dafür sind wesentlich in dem absoluten Mangel an Ressourcen zu finden. Auch wenn einzelnen Träger und Verbände in advokatorischer Absicht sich für wohnungslose Menschen engagieren, so stellt doch ihre Abhängigkeit von den staatlichen Finanzgebern und ihre Eingebundenheit in korporatistische Strukturen eine Grenze ihres Engagements dar. Die Thematisierung von Wohnungslosigkeit als gesellschaftliches Problem bedarf einer Koalition verschiedenster gesellschaftlicher Akteursgruppen mit der Perspektive einer organisatorischen Strukturbildung und weit ausgreifenden Formen der Institutionalisierung, um politische Stoßkraft im gesellschaftlichen Raum dauerhaft wirksam entfalten zu können.
Korrespondierend zu den Institutionalisierungstheoretischen Reflexionen der anderen Beiträge reflektiert Fabian Kessl in seinem Beitrag die 'helle und dunkle' Seite dieses konstitutiven Moments der bürgerlichen Welt. Am Beispiel der pädagogischen Felder weist er auf die Strukturlogik von Institutionalisierung, aber gerade auch auf die Verkürzungs- und Vereindeutigungstendenzen institutionalisierungskritischer Positionen hin, wenn sie nurmehr als generalisierte Institutionenkritik ausformuliert werden. Vor diesem Hintergrund plädiert er für eine konstitutiv dialektische Perspektive auf Institutionalisierung, die gerade aus einer institutionalisierungskritischen Position heraus die Ermöglichungsbedingungen von Institutionalisierung in den Blick rückt.
Die Redaktion