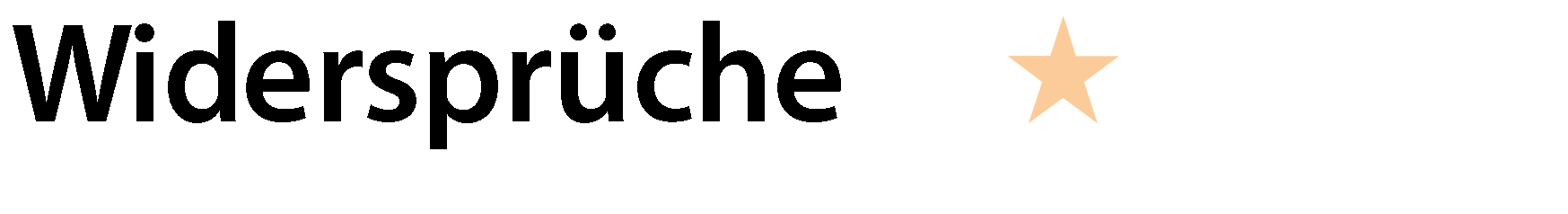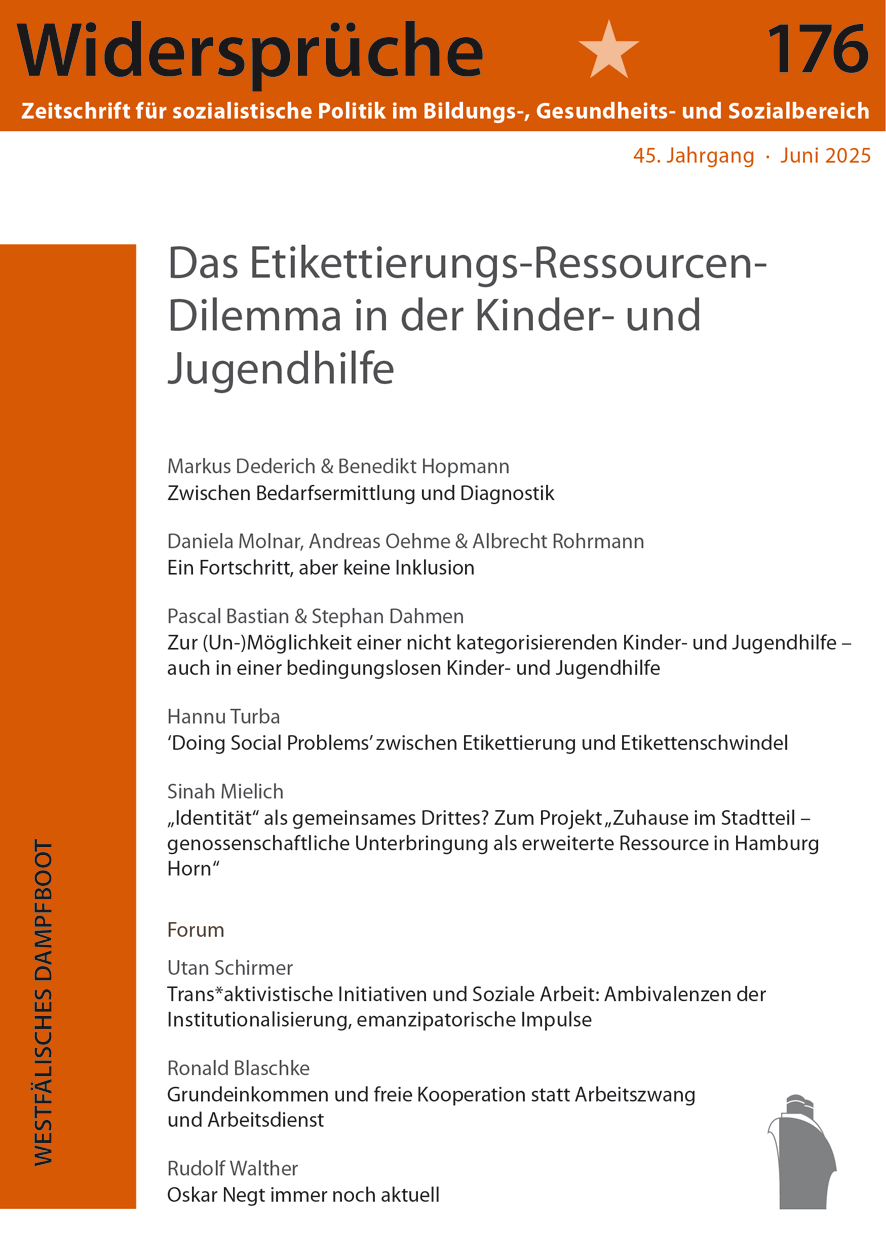
Das Etikettierungs-Ressourcen-Dilemma in der Kinder- und Jugendhilfe
Schwerpunkt
Markus Dederich und Benedikt Hopmann nehmen in ihrem Beitrag aktuelle Diskurse der (De-)Kategorisierung in Sozialpädagogik und Sonderpädagogik pointiert in den Blick und spitzen sie auf die Frage nach der Bedarfsermittlung und Diagnostik zu. Es wird herausgearbeitet, dass immer mehr kategorienbezogene, z.T. auch komplexitätssteigernde Problembeschreibungen hinzukommen, die aber das Grunddilemma des Verhältnisses von Kategorie und Ressource letztlich nur reproduzieren, nicht aber (auf-)lösen können. Es wird resümiert, dass Kategorien einen antinomischen Charakter aufweisen: Sie sind notwendig sowie sinnvoll und sind es zugleich wiederum nicht. Abschließend werden anschlussfähige Perspektiven des Umgangs mit Kategorien aufgezeigt.
Bezugnehmend auf den gegenwärtigen Reformprozess zur inklusiven Kinder- und Jugendhilfe befasst sich das Autor:innenteam Daniela Molnar, Andreas Oehme und Albrecht Rohrmann mit dem Etikettierungs-Ressourcen-Dilemma in den Hilfen zur Erziehung sowie der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen. Die damit einhergehenden Risiken der Stigmatisierung werden in beiden Feldern unterschiedlich bearbeitet: In der Eingliederungshilfe wird ausgehend von der Behindertenbewegung das Recht auf selbstbestimmte Assistenz auf der Grundlage eines standardisierten Verfahrens der Bedarfsermittlung eingefordert, während in der Jugendhilfe im fachlichen Diskurs flexible Hilfen auf der Grundlage eines nichtstandardisierten und partizipativen Hilfeplanverfahrens angestrebt werden. Die Autor:innen gelangen zu der ernüchternden Erkenntnis, dass in den aktuellen Überlegungen zu einer Gesamtzuständigkeit der Kinder- und Jugendhilfe für die bisherigen Eingliederungshilfen und die Hilfen zur Erziehung es noch nicht gelingt, aus den unterschiedlichen Traditionslinien einen inklusiven Ansatz zu entwickeln.
Der Beitrag von Pascal Bastian und Stephan Dahmen diskutiert die (Un-)Möglichkeiten einer nicht, weniger - oder anders kategorisierenden Kinder- und Jugendhilfe. Mit Hinweis auf die stigmatisierenden und defizitorientierten Kategorisierungen der Hilfen zur Erziehung verweist das Projekt einer „bedingungslosen Kinder- und Jugendhilfe“ auf die Notwendigkeit einer universalistisch-infrastrukturellen Ausgestaltung. Die Frage ob – und wenn ja mit welchen Folgen eine (bedingungslose) Kinder- und Jugendhilfe ohne Kategorisierungen auskommt, ist bisher jedoch nicht ausreichend geklärt. Die Ambivalenzen einer (de-)kategorisierenden Kinder- und Jugendhilfe wird in dem Beitrag mit dem speziell hierfür modifizierten Konzept des „Trilemmas der Inklusion“ (Boger 2019) diskutiert. Die Autoren schließen mit zentralen Fragen, die sich aus einer solchen Perspektive an eine bedingungslose Kinder- und Jugendhilfe richten.
Das Etikettierungs-Ressourcen-Dilemma analysiert Hannu Turba in seinem Beitrag durch die Kontrastierung der Kategorien des Kinderschutzes und der Wohnungsnotfallhilfe. Es wird illustriert, wie in Feldern des Sozialwesens mit diversen Problemdiagnosen und Etiketten hantiert wird. Dabei unterscheidet sich der Umgang mit diesen Etiketten zwischen der Makroebene politischer Programme und formaler Organisation auf der einen sowie der Mikroebene konkreter Praxis auf der anderen Seite. Werden diese beiden Seiten dauerhaft voneinander entkoppelt, sei ein Etikettenschwindel die Folge. Gut gemeinte Bemühungen um Etikettierungsvermeidung laufen in diesem Kontext Gefahr, eher den Status quo zu zementieren als nachhaltigen Wandel voranzutreiben.
Als eine Möglichkeit der konsequent nutzerorientierten Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe, die nicht paternalistisch kategorisiert, stellt Sinah Mielich das Projekt „Zuhause im Stadtteil“ vor, in dem förderliche Bedingungen des Aufwachsens geschaffen werden sollen, um zwei aktuell „lebensweltfern“ untergebrachte Heranwachsende in ihren Stadtteil „zurückzuführen“ und auf Dauer angelegte Möglichkeiten der Aneignung, Mitgestaltung und Veränderung des Sozialraums zu realisieren. Theoretisch-konzeptionell wird das Vorhaben genossenschaftlich begründet, ein Ansatz, der neue Formen der institutionellen Hilfeverwaltung ermöglicht, die de-kategorisierendes Potenzial haben und Nutzer:innenpositionen in der Sozialpädagogik zu stärken versprechen.
Forum
Rezensionen
Eingriffe und Positionen
Editorial
Die Kinder- und Jugendhilfe hält sowohl universalistische Leistungen vor, die sich an alle Kinder, Jugendlichen und ihre Eltern richten, als auch selektivistische Leistungen, die an die formale Voraussetzung eines erzieherischen Bedarfs gebunden sind. Im Kontrast zu den eher universalistischen Leistungen (§ 11-26 SGB VIII) wie Kita, Jugendarbeit oder Familienbildung, haben Eltern auf die selektivistischen Leistungen nur dann ein Recht, wenn eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist (§ 27ff.) (Schrödter 2020). Der Selektivismus knüpft die Leistungserbringung somit an das Grenzobjekt „Kindeswohlgefährdung“ (Widersprüche, Heft 149) und damit an Kategorisierungen, die degradierende Etikettierungen nach sich ziehen können und die Frage nach der moralischen Legitimität staatlich verteilter Stigmatisierung aufwerfen (Widersprüche, Heft 153). Die selektivistische Leistungsgewährung erzieherischer Hilfen nach § 27ff. wie Sozialpädagogische Familienhilfe oder die Unterbringung in betreuten Wohnformen („Heimerziehung“) ist auf Kategorisierungen zur Verteilung ihrer Angebote angewiesen und erzeugt sie gleichzeitig (Thalheim 2023).
Sozialleistungsbezogene Kategorisierungen sind auf eine möglichst enge Kopplung von wahrgenommenem Problem und darauf bezogenem Handeln ausgerichtet. In dieser Strukturlogik werden machtvoll die institutionell produzierten Unterschiede, Spaltungen und Hierarchien reproduziert, mit denen Stigmatisierungen konstituiert und fortgesetzt werden (Peters/Düring 2022: 150). Die kategoriale Unterteilung in eine eher universalistische und eher selektivistische Kinder- und Jugendhilfe irritiert allgemeine Inklusionsbestrebungen, die darauf ausgerichtet sind, verbesondernde Unterteilungen zu überwinden, um stigmatisierende Kategorien zu vermeiden (Widersprüche, Heft 146).
Auf der Handlungsebene führt die stigmatisierende Kategorie des erzieherischen Bedarfs zur diagnostischen Herausforderung der Bedarfsermittlung. Die dabei angewendeten Ermittlungsstrategien der Fachkräfte des Jugendamts können degradierende Formen annehmen, um die Fragilität von Eltern zu testen (Freres 2023). Dieses Vorgehen vereinseitigt Responsibilisierungen insbesondere zu Lasten der Mütter und trägt dazu bei, die öffentliche Verantwortung für Heranwachsende zu vernachlässigen (Alberth/Bühler-Niederberger 2017; Oelkers/Richter 2010). Auftretende Widerstände der Eltern gegen erzieherische Hilfen können wiederum mit dem stigmatisierenden Hilfekontext begründet werden, der die Hilfeempfangenden in abweichender Weise kategorisiert. Je nach erfolgter Bedarfskategorisierung werden aus den erzieherischen Hilfen unterschiedliche Interventionen abgeleitet. Dabei entsteht eine Art Stigma-Hierarchie. So scheint im Gegensatz zur niedrigschwelligen Erziehungsberatung eine besondere Stigmatisierungslast für Familien bei der Nutzung von betreuten Wohnformen zu bestehen. Der erzieherische Bedarf lässt sich ferner als Interventionskategorie charakterisieren, die sozialpädagogisches Handeln problembezogen aktiviert und beendet, wodurch Art und Umfang von Hilfeleistungen begrenzt werden, was professionstheoretisch weiter zu reflektieren ist.
Es zeichnet sich ein Spannungsverhältnis zwischen Hilfeadministration, -inanspruchnahme und -vollzug ab, das als „Etikettierungs-Ressourcen-Dilemma“ gefasst werden kann. Es zeugt von dem Dilemma, Ressourcen zielgerichtet und erfolgsversprechend zu verteilen, ohne durch Etikettierungen zu stigmatisieren – ein Widerspruch, der nach wie vor unauflösbar scheint. Wie kann das Etikettierungs-Ressourcen-Dilemma in Bezug auf die Kinder- und Jugendhilfe theoretisch konzeptualisiert, analysiert und praktisch bearbeitet werden?
Das Dilemma wird in der Literatur zu Fragen der Verteilung sozialpolitischer Leistungen sowie von pädagogischen Förderbemühungen zwar immer wieder in kritischer Absicht erwähnt, um die damit einhergehenden Etikettierungen zu problematisieren (Molnar 2021; Neumann/Lütje-Klose 2020). Detaillierte Analysen und Lösungsansätze insbesondere für die Kinder- und Jugendhilfe stehen bislang jedoch aus. Es gibt Ansätze, die sich für eine Dekategorisierung aussprechen (für die Inklusionspädagogik vgl. Quante/Wiedebusch 2018; Hinz/Köpfer 2016). Instruktiv ist die Unterscheidung zwischen Kategorien, die der Verwaltung und Sortierung von Fällen und der Gewährleistung von Hilfeleistungen dienen, einerseits, und solchen, die im Interaktionsprozess ausgehandelt werden und von denen angenommen wird, dass sie geringere Etikettierungseffekte bewirken, andererseits („Verwaltungsdiagnostik“ vs. Prozessdiagnostik: vgl. Boger 2018).
In systemtransformativer Absicht wird gegenwärtig für die Kinder- und Jugendhilfe die Idee diskutiert, auf die Kategorie des erzieherischen Bedarfs ganz zu verzichten und Hilfen zur Erziehung bedingungslos zugänglich zu machen (vgl. DFG-Netzwerk Bedingungslose Jugendhilfe 2025). Mit diesem transformativen Ansatz wird intendiert, die Inanspruchnahme von Hilfen zur Erziehung zu entstigmatisieren, die Inanspruchnahmebereitschaft zu stärken sowie die interventionistische Engführung von Hilfeformaten aufzubrechen. Gedanklich ist diese Transformationsperspektive eng verbunden mit dem Grundanliegen der Kinder- und Jugendhilfe: Denn wenn ihr Ziel in der „Erziehung zu einer selbstbestimmten, eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit“ (§ 1 Abs. 1 SGB VIII) besteht, können auch jenseits der in § 27 Abs. 1 SGB VIII formulierten Tatbestandsvoraussetzungen Gründe vorliegen, um Hilfeleistungen in Anspruch zu nehmen (Patjens 2024). Denn der erzieherische Bedarf als Leistungsvoraussetzung stellt eine sehr hohe Hürde dar. Mit Bezug auf die Förderkriterien des § 1 Abs. 1 SGB VIII könnten hingegen junge Menschen auch bei einem weitaus niedrigeren Hilfebedarf individualisierte Unterstützung beanspruchen (Patjens 2024). Wohlfahrtstheoretisch ist die Idee einer so verstandenen bedingungslosen Kinder- und Jugendhilfe universalistischen Ansätzen zuzuordnen (u.a. Korpi/Palme 1998), die mit einer weitgehenden Dekonditionalisierung staatlicher Leistungen verknüpft sind, wodurch in demokratischer Absicht die Nutzer:innenposition gestärkt werden soll (Ziegler 2022).
Des Weiteren wurde vorgeschlagen, Etikettierungsprozessen entgegenzuwirken, indem die Adressat:innen im Sinne eines care-ethischen Zugangs stärker dialogisch in den Prozess der Bedarfsermittlung und Bedürfnisinterpretation eingebettet werden (Kutscher 2020). Solche care-ethischen Perspektiven verweisen wiederum darauf, dass Fragen der gesellschaftlichen Verteilung von Sozialleistungen letztlich Fragen der sozialen Infrastruktur sind (Widersprüche, Heft 97).
Das Etikettierungs-Ressourcen-Dilemma verweist darauf, dass die Kinder- und Jugendhilfe kategorienbezogen verwaltet, aktiv und begrenzt wird. Gleiches gilt im Übrigen für die Kategorie der Behinderung und für die Eingliederungshilfen nach SGB IX. Im Reformprozess zur inklusiven Kinder- und Jugendhilfe wird das Selektivismus-Problem kaum berücksichtigt. Die Reflexion des Etikettierungs-Ressourcen-Dilemma verspricht daher, das Ringen um Inklusion als allgemeine Herausforderung für die gegenwärtigen Reformbemühungen der Kinder- und Jugendhilfe zuzuspitzen und zu schärfen.
Der selektive Verteilungsmodus der Leistungsgewährung führt zu einem komplexen Geflecht aus Angebotskategorien, Bedarfskategorien und Interventionskategorien, deren Interdependenz in diesem Schwerpunktheft im Hinblick auf das „Etikettierungs-Ressourcen-Dilemma“ analysiert werden soll. Dabei soll unter anderem reflektiert werden, ob dieses Dilemma, das bislang vorwiegend in der Inklusionsdebatte diskutiert worden ist, auch für die Kinder- und Jugendhilfe neue Einsichten verspricht.
In Heft 153 wurde analysiert, inwiefern stigmatisierende Aspekte von Kategorisierungen als ätiologische Faktoren reifiziert werden. Es wurde kritisiert, dass hierbei Goffmans Einsicht widersprochen wird, der Stigmatisierungen als relationale Konstruktionen gefasst hat und nicht als manifeste Eigenschaften von Personen. Diese Fehldeutung würde dazu beitragen, weniger die Prozesse der Kategorisierungen zu analysieren, als vielmehr Euphemismen und Umgangsweisen für deren stigmatisierende Konsequenzen zu beleuchten. Entwicklungen in der Kinder- und Jugendhilfe scheinen diese Kritik zu bestätigen. So wurden bei dem 1990 verabschiedeten Kinder- und Jugendhilfegesetz sprachliche Veränderungen vorgenommen und eindeutig stigmabehaftete Bezeichnungen wie „Verwahrlosung“ oder „schwererziehbar“ ersatzlos gestrichen (Rätz 2018: 81). Und jüngst wurde im Referentenentwurf eines Kinder- und Jugendhilfeinklusionsgesetzes (IKJHG) vorgeschlagen, den Begriff der Heimerziehung zugunsten dem der „betreuten Wohnformen“ zu streichen – was gleichsam die Forderung von Careleaver aufgreift. Ferner wird Öffentlichkeitsarbeit geleistet, bei der etwa für vielfältige Formen des Heranwachsens sensibilisiert oder von Erfolgsgeschichten der Heimerziehung berichtet wird (Zukunftsforum Heimerziehung 2021). Die institutionellen Strukturen, die die Kategorisierungsprozesse konstituieren, bleiben jedoch unangetastet.
Vorliegender Schwerpunkt versucht, an die Kritik aus Heft 153 anzuschließen und die relationalen Bezüge zwischen Angebots-, Bedarfs-, und Interventionskategorien der Kinder- und Jugendhilfe zu analysieren und der Einsicht Rechnung zu tragen, dass Stigmatisierungen in der Sozialen Arbeit nicht allein auf das Interventionsverhältnis beschränkt werden können, sondern auch das Ergebnis sozialpolitischer Entscheidungen für die Verwaltung von Hilfeleistungen sind. Vor diesem Hintergrund fragen wir in diesem Schwerpunkt nach den konstitutiven Prozessen der vielseitigen Kinder- und Jugendhilfekategorien auf gesellschaftlicher, institutioneller und interaktiver Ebene. Wie stehen Kategorisierung, Etikettierung und Stigmatisierung zueinander? Welche Konsequenzen folgen daraus für die Hilfegewährung, Durchführung und die als Nutzer:innen dieser Angebote kategorisierten Personen? Kann Inklusion als normatives Leitprinzip der aktuellen Reformprozesse mit dem Selektivismus in der Kinder- und Jugendhilfe vereinbart werden oder sind grundlegendere Reformen nötig?
Literatur
Ackermann, Timo 2017: Über das Kindeswohl entscheiden. Eine ethnographische Studie zur Fallarbeit im Jugendamt. Bielefeld
Alberth, Lars/ Bühler-Niederberger, Doris 2017: The overburdened mother: How social workers view the private sphere. In: Betz, Tanja/ Honig, Michael-Sebastian/ Ostner, Ilona (Hrsg.): Parents in the Spotlight (Reihe: Journal of Family Research. Special Issue). Opladen: 153-170
Boger, Mai-Anh 2018: Depathologisierung – Diagnostik der emotionalen und sozialen Entwicklung im inklusiven Kontext. In: Zeitschrift für Inklusion
DFG-Netztwerk Bedingungslose Jugendhilfe 2025: Das Projekt. Online unter: [www.bedingungslose-jugendhilfe.de] Letzter Zugriff: 23.04.2025
Freres, Katharina 2023: Risikomanagement im Kinderschutz. Urteils- und Entscheidungsfindung bei Kindeswohlgefährdung durch Fragilitätstests. Weinheim
Hinz, Andreas/ Köpfer, Andreas 2016: Unterstützung trotz Dekategorisierung? In: Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete (85)1, 36-47
Korpi, Walter/ Palme, Joakim 1998: The Paradox of Redistribution and Strategies of Equality: Welfare State Institutions, Inequality and Poverty in the Western Countries. American Sociological Review, 63, 661-687
Molnar, Daniela/ Oehme, Andreas/ Renker, Anna/ Rohrmann, Albrecht 2021: Kategorisierungsarbeit in Hilfen für Kinder und Jugendliche mit und ohne Behinderung. Eine vergleichende Untersuchung. Weinheim
Neumann, Phillip/ Lütje-Klose, Birgit 2020: Diagnostik in inklusiven Schulen – zwischen Stigmatisierung, Etikettierungs-Ressourcen-Dilemma und förderorientierter Handlungsplanung. In: Gresch, Cornelia/ Kuhl, Poldi/ Grosche, Michael/ Sälzer, Christine/ Stanat, Petra (Hrsg.): Schüler*innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf in Schulleistungserhebungen. Wiesbaden: 3-28
Oelkers, Nina/ Richter, Martina 2010: Die post-wohlfahrtsstaatliche Neuordnung des Familialen. In: Böllert, Karin/ Oelkers, Nina (Hrsg.): Frauenpolitik in Familienhand? Neue Verhältnisse in Konkurrenz, Autonomie oder Kooperation. Wiesbaden: 15-23
Patjens, R. 2024: Das Erziehungsziel einer selbstbestimmten Persönlichkeit weiter denken! Sozial Extra. 48: 15-18.
Peters, Friedhelm/ Düring, Diana 2022: „Geschichte wird gemacht – es geht voran“? ein wenig, vielleicht oder doch nicht? Zu den Ergebnissen des Zukunftsforums Heimerziehung. Forum Erziehungshilfen. 28, 148-152
Quante, Michael/ Wiedebusch, Silvia 2018: Die Dekategorisierungsdebatte im Kontext Inklusiver Bildung. In: Wiedebusch, Silvia/ Quante, Michael/ Wulfekühler, Heidrun (Hrsg.): Ethische Dimensionen Inklusiver Bildung. Weinheim: 119-141
Rätz, Regina 2018: Von der Fürsorge zur Dienstleistung. In: Böllert, Karin (Hrsg.): Kompendium Kinder- und Jugendhilfe. Wiesbaden: 65-92
Redaktion Widersprüche (Hrsg.) 2003: Neo-Diagnostik. Modernisierung klinischer Professionalität, 88
- 2005: Politik des Sozialen – Alternativen zur Sozialpolitik. Umrisse einer Infrastruktur, 97
- 2017: Am Ende Inklusion? „Reform“ der Kinder- und Jugendhilfe, 146
- 2018: Bestärken und Einsperren. Kindeswohl als Kindeswohlgefährdung?, 149
- 2019: Die Macht von Bezeichnungen. Zur Aktualität von Etikettierungstheorien, 153
Schrödter, Mark 2020: Bedingungslose Jugendhilfe. Von der selektiven Abhilfe defizitärer Elternschaft zur universalen Unterstützung von Erziehung (unter Mitarbeit von K. Freres & V. Thalheim). Wiesbaden
Thalheim, Vinzenz 2023. Bausteine einer Stigma-Theorie für die Soziale Arbeit. In: Zeitschrift für Sozialpädagogik, 21: 347-366
Ziegler, Holger 2022: Zweieinhalb Debattenstränge zur Infrastruktur. Soziale Passagen, 14(1), 13-22
Zukunftsforum Heimerziehung. 2021: Zukunftsimpulse für die »Heimerziehung«. Eine nachhaltige Infrastruktur mit jungen Menschen gestalten! Frankfurt/M.
Redaktion des Heftes:
Vinzenz Thalheim
E-Mail: vthalheim@uni-kassel.de
Mark Schrödter