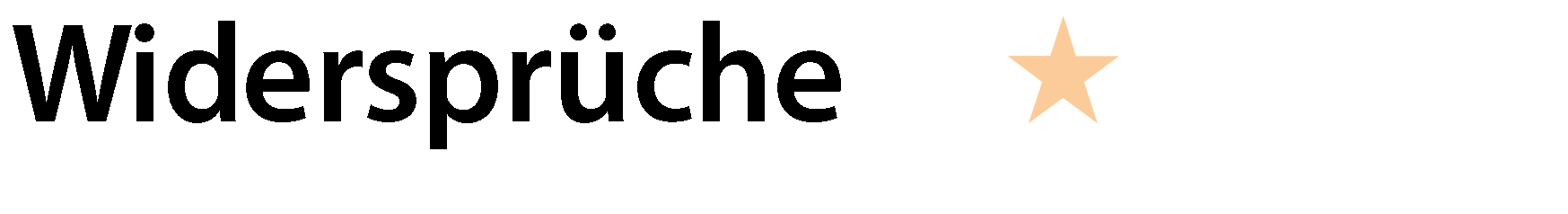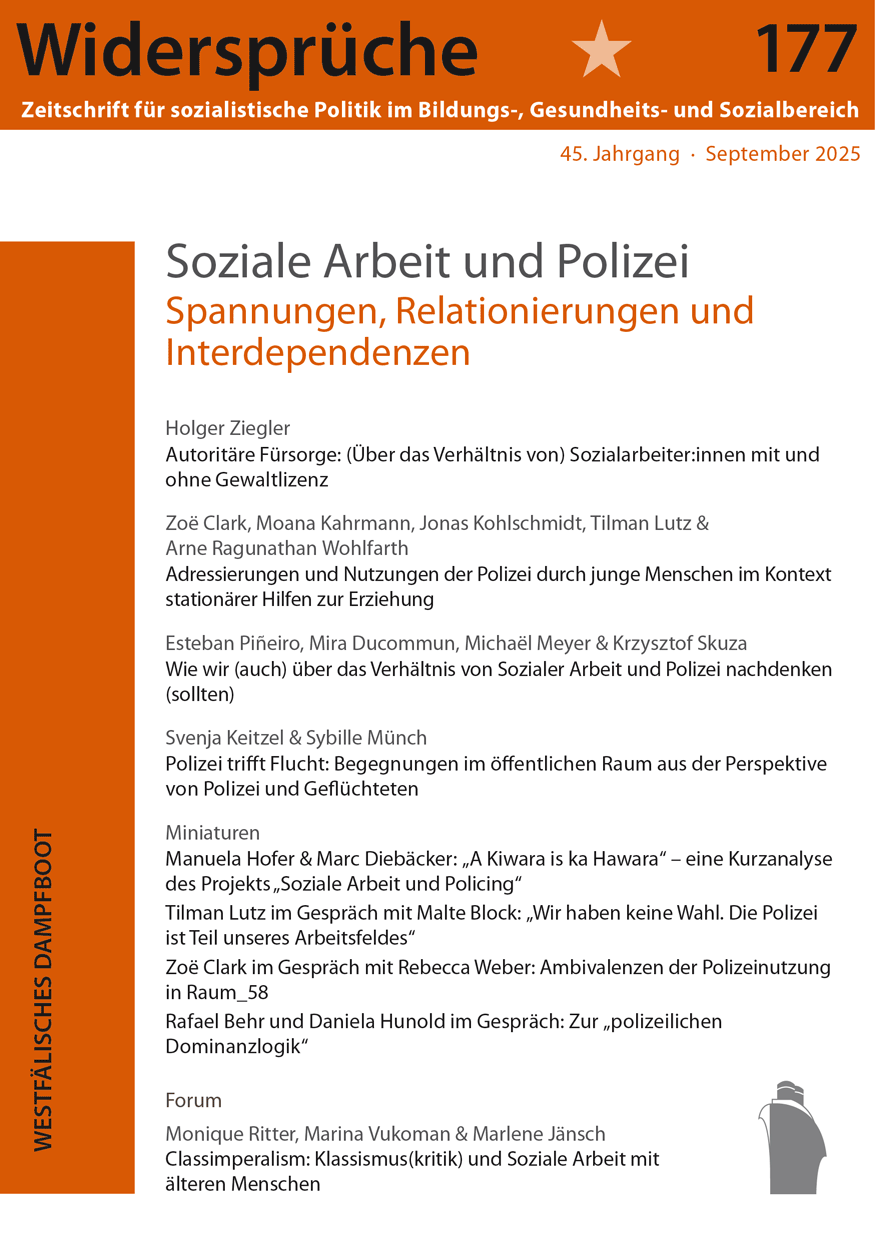
Soziale Arbeit und Polizei
Schwerpunkt
In seinem einführenden Beitrag diskutiert Holger Ziegler Kernaspekte der Debatte um die Kooperation von Sozialer Arbeit und Polizei. Er argumentiert, dass zahlreiche ‚kritische-konstruktive‘ Argumente durch eine seltsam verzerrte Geschichte mit Moral gerahmt werden. Dabei wird nicht nur das Problem ‚over-criminalisation‘ erörtert, sondern insbesondere auch eine selektive ‚under-protection‘ sowie die Problematik selektiver ‚modes of protection‘. Holger Ziegler akzentuiert den ‚Wandel‘ der Sozialen Arbeit (ohne Gewaltlizenz) stärker als den vermeintlichen Wandel der Polizei zu autoritär-fürsorglichen ‚Sozialarbeiter:innen mit Gewaltlizenz‘. Formalisierte Kooperationsformate seien oft v.a. Symbolpolitik und hätten insgesamt die Gemeinsamkeit, nicht folgenlos aber weitgehend erfolglos zu bleiben. In dem Beitrag wird die These begründet, dass institutionalisierte Kooperationsformate zwischen Polizei und Sozialer Arbeit weniger bedeutsam seien als Formen der Alltagskooperation. Dabei sei eine ‚Instrumentalisierung‘ der Polizei durch die Soziale Arbeit nicht weniger irritierend als eine ‚Kolonialisierung‘ der Sozialen Arbeit durch die Polizei.
Zoë Clark, Moana Kahrmann, Jonas Kohlschmidt, Tilman Lutz und Arne Ragunathan Wohlfarth nehmen in ihrem Beitrag das aktuell laufende, von der DFG geförderte Forschungsprojekt „Polizei als Partnerin der Heimerziehung? Die professionelle Gestaltung des Verhältnisses von Heimerziehung und Polizei als Erfahrungshorizont junger Menschen“ zum Ausgangspunkt, um die bislang wenig beachtete Perspektive junger Menschen auf Polizeikontakte im Kontext stationärer Hilfen zur Erziehung in den Blick zu nehmen. Auf Basis von Zwischenergebnissen des Projektes rekonstruieren sie Adressierungen der Polizei durch die jungen Menschen. Dabei zeigt sich, dass diese die Polizei trotz Erfahrungen von Zurückweisungen, Missachtungen und Gewalt als potenziell helfende und letztinstanzlich rettende Institution beschreiben.
Auf Basis eines laufenden Forschungsprojektes – „Polizeiarbeit mit psychisch belasteten Personen. Ethnographische Perspektiven auf interaktionale und organisationale Kategorisierungen in der Schweizer Sicherheitspolizei“ – weisen Esteban Piñeiro, Mira Ducommun, Michaël Meyer und Krzysztof Skuza auf Verkürzungen in der Debatte um das vielfach dualistisch entworfene Verhältnis zwischen Sozialer Arbeit und Polizei hin. Am Beispiel einer „Exmissionspraxis“ wird deutlich, dass das Aufeinandertreffen der Institutionen weniger von „Sinndeutungen und Motiven“ einzelner Akteur:innen bestimmt wird als von einem „vielschichtigen Zusammenspiel mannigfaltiger Praxen“. Aus einer praxeologischen Perspektive geraten die konkreten Vollzugswirklichkeiten und situativen Verflechtungen von Polizei, Sozialer Arbeit und weiteren Beteiligten in den Blick: Das Verhältnis von Sozialer Arbeit und Polizei wird so als sich im Vollzug spezifischer Maßnahmen immer wieder neu Herzustellendes und Formendes sichtbar. Dies wirft die Frage auf, welche staatlichen Eingriffspraktiken durch Soziale Arbeit – unabhängig von ihrem Selbstverständnis – situativ ermöglicht werden.
Svenja Keitzel und Sybille Münch verschränken die Befunde aus zwei abgeschlossenen Forschungsprojekten: „Polizei, Politik, Polis – Zum Umgang mit Geflüchteten in der Stadt“, welches polizeiliche Wahrnehmungen von Fluchtmigration untersucht hat, mit den Ergebnissen einer Dissertation zu Erfahrungen von rassismusbetroffenen Personen mit der Polizei. Im Fokus ihres Beitrags stehen die folgenreichen Begegnungen zwischen Polizei und migrantisierten Personen im öffentlichen Raum, die durch diese doppelte Perspektivierung analytisch greifbar werden. Vor dem Hintergrund der hohen Wirkmächtigkeit und Aufgeladenheit solcher Erfahrungen arbeiten sie mit dem Vergleich der polizeilichen Perspektive mit der des „polizeilichen Gegenübers“ die Aspekte von Vertrauen und Machtasymmetrien als besonders prägend für diese Interaktionen heraus. Dabei identifizieren die Autor:innen zentrale Differenzen in der Deutungs- und Umgangsweise.
Miniaturen
Manuela Hofer und Marc Diebäcker präsentieren in ihrer Kurzanalyse des Projektes „SwaPol Social Work and Policing“ wie sich bestimmte Annahmen und Vorstellungen von Sicherheit und Ordnung in Fortbildungsprojekten für die Zusammenarbeit zwischen Sozialer Arbeit und Polizei einschreiben. Die auf dem zum Projekt dazugehörigen Handbuch sowie begleitenden Artikel bestehende kritische Analyse zeigt, wie Soziale Arbeit in diesen Formaten in sicherheitspolitische Logiken eingebunden wird und wie sich normative Erwartungen, asymmetrische Machtverhältnisse und funktionale Einpassungen in polizeiliche Strategien durchsetzen.
In der Miniatur steht Malte Block, Leiter des „KIDS - Anlaufstelle für junge Menschen in besonderen Lebenslagen“ in Hamburg im Gespräch mit Tilman Lutz. Ausgangspunkt des Gesprächs ist die Ausgestaltung der zwangsläufigen Begegnungen mit der Polizei und der Umgang mit institutionellen Schnittmengen in der, auch aufsuchenden, Sozialen Arbeit des KIDS. Dabei wird deutlich, wie im Spannungsfeld zwischen Kontrolle, Prävention und Schutzraumgestaltung navigiert wird und welche Strategien entwickelt werden, um trotz struktureller Zielkonflikte handlungsfähig zu bleiben.
Die hochkomplexe professionelle Gestaltung von und der Umgang mit Polizeikontakten – deren Abwehr zum Schutz der jungen Menschen, aber auch das Involvieren der Polizei steht im Fokus des Interviews, dass Zoë Clark mit Rebecca Weber geführt hat.
Daniela Hunold und Rafael Behr erörtern das Verhältnis von Polizei und Sozialer Arbeit im Dialog aus der Perspektive der Polizeiforschung. Inner- oder unterhalb der von ihnen konsensual diagnostizierten polizeilichen Dominanz in situativ-alltäglichen wie strukturellen Begegnungen und Formen der Zusammenarbeit sowie differenten Aufgaben verweisen sie auf Überschneidungen, wechselseitige Bezugnahmen sowie Annäherungspraxen und -praktiken in Gegenwart und Vergangenheit, die auch zu gemeinsamen Problem(re)produktionen führen.
Forum
Der Forumsbeitrag thematisiert die Vernachlässigung von Klassismus in der Sozialen Altenarbeit, wodurch sich ein Classimperalism einer Mittelschichtsorientierung etablieren könne. Klassismus durchzieht, so die Feststellung, alle gesellschaftlichen Strukturen und kann sich im Alter verstärken. Der Beitrag analysiert diese Manifestationen von Klassismus im Alter und wirft einen kritischen Blick auf Konzepte der Sozialen Altenarbeit. Betont wird die Notwendigkeit einer klassismuskritischen Reflexion und gerechten Ressourcenverteilung in der Sozialen Arbeit mit älteren Menschen
Rezensionen
Die Rezension von Martina Pistor beschäftigt sich mit dem 2023 erschienenen Buch „asozial – dissozial – antisozial. Wider die Politik der Ausgrenzung“ und ordnet das Buch als breites Forum für sehr unterschiedliche Kritiken am Konzept der dis-/asozialen Persönlichkeitsstörung ein.
Eingriffe und Positionen
Passend zum Thema des Schwerpunktes kritisiert der Text des Solidaritätskreis Justice4Mouhamed in der Rubrik Eingriffe&Positionen die tödliche Polizeigewalt gegen den 16-jährigen Mouhamed Lamine Dramé, der am 8. August 2022 in Dortmund während einer psychischen Krise von der Polizei erschossen wurde. Der Prozess gegen fünf Angeklagte Beamt:innen endete im Dezember 2024 mit Freisprüchen, was die Familie und Unterstützer:innen als Verweigerung von Gerechtigkeit bewerten. Der Text fordert u. A. strukturelle Veränderungen im Umgang mit psychischen Krisen, eine angemessene Unterstützung für Opfer von Polizeigewalt und Angehörige und die Entwicklung alternativer Interventionsmöglichkeiten, um weitere Todesfälle zu verhindern.
Editorial
Zu diesem Heft
Ausgangspunkt des Heftes ist die breite Diskussion über institutionelle und professionsbezogene Neujustierungen im Verhältnis von Sozialer Arbeit und Polizei. Das Verhältnis der beiden Instanzen ist historisch seit der Ausdifferenzierung respektive Begrenzung der für alle regulierenden „Tätigkeiten des Staates nach Innen“ (gewissermaßen allzuständigen) „guten Polizey“ (Pütter 2022: 15) wechselvoll. Dies wurde in den Widersprüchen immer wieder thematisiert, schon in Heft 9 mit dem Aufsatz von Wolfgang Völker: „Sozialpolizei – gibt’s das?“. Meist waren die Heftschwerpunkte – wie in Heft 9, das sich mit der Herstellung von Sündenböcken befasst hat – nicht genuin auf das Verhältnis von Sozialer Arbeit und Polizei bezogen, das Thema tauchte im Kontext veränderter Präventionsverständnisse und Praxen (insbes. Heft 79 und 139) sowie der kritischen Thematisierung von Kriminalisierungen und wohlfahrtsstaatlichen Transformationsprozessen auf. Dezidiert wurde das Thema zuletzt in der Auseinandersetzung mit der Versicherheitlichung von Gesellschaft behandelt: Safety first! (Heft 86).
In der so genannten „Sicherheitsgesellschaft“ (Singelnstein/Stolle 2012) lassen sich politische, institutionelle und professionsbezogene Neujustierungen beobachten, die die früher – zumindest im Diskurs seitens der Sozialen Arbeit – deutlich gezogenen Differenzlinien aufweichen (bspw. Lutz 2017; Scherr/Schweitzer 2021). Heutzutage dominieren dagegen die These einer Annäherung sowie programmatisch-politische Forderungen nach Kooperation. Deren Realisierung zeigt sich beispielsweise in der Implementation von Konzepten bürger:innennaher Polizeiarbeit (z.B. in Formen von community policing und kriminalpräventiven Räten) seit den 1990ern (Scherr/Schweitzer 2021: 152f), dem massiven Ausbau der Häuser des Jugendrechts (Schaerff/Lohrmann 2023) seit den 2000ern, Vorschläge für gemeinsam genutzte Diagnoseinstrumente (kritisch: Lindenberg/Lutz 2021) bis hin zur Feststellung der Zusammenarbeit als alternativlose Notwendigkeit und „große Chance zur Bewältigung komplexer sozialer Probleme“ (Laabich 2025: 29). Argumentiert wird mit den Gemeinsamkeiten, etwa mit der Polizei als bürger:innenorientierter Dienstleisterin, die wie Soziale Arbeit eine allzuständige, „unspezifische Abhilfeinstanz“ (Hanak et al. 1989: 141) sei, die immer erreichbar ist, oder auch mit der Konstruktion gemeinsamer Adressat:innengruppen und Ziele, die zu einer Annäherung geführt haben.
Kritisiert werden diese Entwicklungen im sozialarbeiterischen Diskurs als Subordination der Sozialen Arbeit unter polizeiliche Rationalitäten (Fritsch/Paustian 2019: 212) und Gefahr einer Verwässerung der Arbeitsfelder und ihrer Differenzen (Pütter 2022: 54ff) – Ziegler (2001) spricht zugespitzt von „Crimefighters United“. In dieser Entwicklung wird sowohl eine „Verpolizeilichung der Sozialen Arbeit“ (ebd.) als auch eine „Versozialarbeiterung“ und „Sozialprofessionalisierung der Polizei“ (Turba 2018: 5) diagnostiziert: „Während sich Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter immer mehr als Kontrolleure verstehen, leisten Polizistinnen und Polizisten verstärkt Beziehungsarbeit“ (Fritsch 2019: 171).
Dabei wird, wie in dem Zitat, eine veränderte Ausrichtung der Sozialen Arbeit diskutiert, die polizeiliche Rationalitäten affiziere (bspw. Schuhmacher 2021; Dollinger 2020: 88; Kühne/Schlepper 2019) und im Kontext eines ‚repressiven turn‘ in der Sozialen Arbeit stehe (Clark 2018; Lutz 2017; Widersprüche Heft 154).
Verkürzt gesagt stehen in den aktuellen Debatten vor allem polarisierende Positionen und Gegenüberstellungen im Raum, die einerseits die ordnungspolitischen Aufgaben Sozialer Arbeit betonen und die Gestaltung eines Kooperationsverhältnisses mit der Polizei einfordern. Andererseits steht die Kriminalisierung der Adressat:innen im Zusammenspiel von Sozialer Arbeit und Polizei als quasi antagonistischen Instanzen in der Kritik. Noch knapper: „Gegner, Konkurrenten oder Verbündete?“ (Scherr/Schweitzer 2021).
Solche Vereindeutigungen verkürzen die Bandbreite der Praxen, Analysen und Diskurse, die von Widersprüchen, Ambivalenzen und Konflikten durchzogen sind. So mangelt es auf „disziplinärer Seite“, also im wissenschaftlichen Diskurs, mit Piñeiro et al. (2016: 11) gesprochen an „theoretisch und empirisch fundierte[n] Analysen des Verhältnisses von Sozialer Arbeit und Polizei“ (auch Clark/Lutz i.E.). Mit Blick auf die Empirie verschleiert schon die Gegenüberstellung von der Sozialen Arbeit und der Polizei die Differenzen, die in deren Heterogenität gründen (Schuhmacher 2021: 1788). Aufträge und Selbstbilder der „Jugendarbeit“ der Polizei unterscheiden sich ebenso von denen der Bereitschaftspolizei wie Häuser der Jugend bei freien Trägern von der Jugendhilfe im Strafverfahren. Zudem stehen empirisch wie analytisch regelhaft das Zusammenspiel, Neben- oder Gegeneinander von Sozialarbeitenden und Polizist:innen im Fokus von Studien und Analysen, während die Perspektive der Adressat:innen und weiterer Betroffener kaum berücksichtigt wird (Clark/Lutz i.E.).
Die damit verbundene Differenzierungsnotwendigkeit und die Aufforderung, „genau hinsehen, geduldig nachdenken, sich nicht dumm machen lassen“ (Steinert 2024), steht zentralen strukturellen Differenzen keineswegs entgegen: die Polizei agiert aufgrund kriminalisierbarer Handlungen bzw. akuter Gefahrenlagen, die situativ abgewehrt bzw. entschärft oder verfolgt werden müssen, während Soziale Arbeit aufgrund von Konflikten mit Anforderungen der Gesellschaft bzw. des Alltags tätig wird und auf die Erweiterung von Handlungsfähigkeiten zielt. Zudem ist das strukturelle Verhältnis zwischen Polizei und Sozialer Arbeit fraglos asymmetrisch: sowohl mit Blick auf die „unterschiedlich verteilten Machtmitteln und Legitimierungen“ (Schuhmacher 2021: 1788), zentral dem Gewaltmonopol, das das Handeln der Polizei prägt, als auch in den Organisationsprinzipien und unterschiedlichen Graden der relativen Autonomie. Nicht zuletzt ist die Polizei aus ebenso nachvollziehbaren Gründen dem Strafverfolgungszwang unterworfen wie Sozialarbeiter:innen der Schweigepflicht unterliegen.
Dieses Heftes legt den Schwerpunkt auf empirische Untersuchungen und thematisiert in den Miniaturen Reflexionen aus aktivistischen und handlungspraktischen Perspektiven, ohne die analytisch-programmatische Dimension, die strukturelle Verfasstheit und entsprechende Fragen zu vernachlässigen. Unter anderem werden unterschiedliche Perspektiven von Adressat:innen der Sozialen Arbeit sowie der Polizei beleuchtet und damit Einblicke in konkrete Prozesse gegeben, die in der bisherigen Debatte und Forschung häufig abstrakt bleiben. Indem das Heft theoretische Rahmungen, subjektive Perspektiven und Erfahrungen sowie institutionelle Praktiken thematisiert, will es die Diskussion um das Verhältnis von Sozialer Arbeit und Polizei differenziert erweitern – ohne die politischen Implikationen dieser Beziehung aus dem Blick zu verlieren.
Zu den Beiträgen im Einzelnen
In seinem einführenden Beitrag diskutiert Holger Ziegler Kernaspekte der Debatte um die Kooperation von Sozialer Arbeit und Polizei. Er argumentiert, dass zahlreiche ‚kritische-konstruktive‘ Argumente durch eine seltsam verzerrte Geschichte mit Moral gerahmt werden. Dabei wird nicht nur das Problem ‚over-criminalisation‘ erörtert, sondern insbesondere auch eine selektive ‚under-protection‘ sowie die Problematik selektiver ‚modes of protection‘. Holger Ziegler akzentuiert den ‚Wandel‘ der Sozialen Arbeit (ohne Gewaltlizenz) stärker als den vermeintlichen Wandel der Polizei zu autoritär-fürsorglichen ‚Sozialarbeiter:innen mit Gewaltlizenz‘. Formalisierte Kooperationsformate seien oft v.a. Symbolpolitik und hätten insgesamt die Gemeinsamkeit, nicht folgenlos aber weitgehend erfolglos zu bleiben. In dem Beitrag wird die These begründet, dass institutionalisierte Kooperationsformate zwischen Polizei und Sozialer Arbeit weniger bedeutsam seien als Formen der Alltagskooperation. Dabei sei eine ‚Instrumentalisierung‘ der Polizei durch die Soziale Arbeit nicht weniger irritierend als eine ‚Kolonialisierung‘ der Sozialen Arbeit durch die Polizei.
Zoë Clark, Moana Kahrmann, Jonas Kohlschmidt, Tilman Lutz und Arne Ragunathan Wohlfarth nehmen in ihrem Beitrag das aktuell laufende, von der DFG geförderte Forschungsprojekt „Polizei als Partnerin der Heimerziehung? Die professionelle Gestaltung des Verhältnisses von Heimerziehung und Polizei als Erfahrungshorizont junger Menschen“ zum Ausgangspunkt, um die bislang wenig beachtete Perspektive junger Menschen auf Polizeikontakte im Kontext stationärer Hilfen zur Erziehung in den Blick zu nehmen. Auf Basis von Zwischenergebnissen des Projektes rekonstruieren sie Adressierungen der Polizei durch die jungen Menschen. Dabei zeigt sich, dass diese die Polizei trotz Erfahrungen von Zurückweisungen, Missachtungen und Gewalt als potenziell helfende und letztinstanzlich rettende Institution beschreiben.
Ebenfalls auf Basis eines laufenden Forschungsprojektes – „Polizeiarbeit mit psychisch belasteten Personen. Ethnographische Perspektiven auf interaktionale und organisationale Kategorisierungen in der Schweizer Sicherheitspolizei“ – weisen Esteban Piñeiro, Mira Ducommun, Michaël Meyer und Krzysztof Skuza auf Verkürzungen in der Debatte um das vielfach dualistisch entworfene Verhältnis zwischen Sozialer Arbeit und Polizei hin. Am Beispiel einer „Exmissionspraxis“ wird deutlich, dass das Aufeinandertreffen der Institutionen weniger von „Sinndeutungen und Motiven“ einzelner Akteur:innen bestimmt wird als von einem „vielschichtigen Zusammenspiel mannigfaltiger Praxen“. Aus einer praxeologischen Perspektive geraten die konkreten Vollzugswirklichkeiten und situativen Verflechtungen von Polizei, Sozialer Arbeit und weiteren Beteiligten in den Blick: Das Verhältnis von Sozialer Arbeit und Polizei wird so als sich im Vollzug spezifischer Maßnahmen immer wieder neu Herzustellendes und Formendes sichtbar. Dies wirft die Frage auf, welche staatlichen Eingriffspraktiken durch Soziale Arbeit – unabhängig von ihrem Selbstverständnis – situativ ermöglicht werden.
Svenja Keitzel und Sybille Münch verschränken die Befunde aus zwei abgeschlossenen Forschungsprojekten: „Polizei, Politik, Polis – Zum Umgang mit Geflüchteten in der Stadt“, welches polizeiliche Wahrnehmungen von Fluchtmigration untersucht hat, mit den Ergebnissen einer Dissertation zu Erfahrungen von rassismusbetroffenen Personen mit der Polizei. Im Fokus ihres Beitrags stehen die folgenreichen Begegnungen zwischen Polizei und migrantisierten Personen im öffentlichen Raum, die durch diese doppelte Perspektivierung analytisch greifbar werden. Vor dem Hintergrund der hohen Wirkmächtigkeit und Aufgeladenheit solcher Erfahrungen arbeiten sie mit dem Vergleich der polizeilichen Perspektive mit der des „polizeilichen Gegenübers“ die Aspekte von Vertrauen und Machtasymmetrien als besonders prägend für diese Interaktionen heraus. Dabei identifizieren die Autor:innen zentrale Differenzen in der Deutungs- und Umgangsweise.
Der Schwerpunkt des Heftes wird um vier Miniaturen ergänzt.
Manuela Hofer und Marc Diebäcker präsentieren in ihrer Kurzanalyse des Projektes „SwaPol Social Work and Policing“ wie sich bestimmte Annahmen und Vorstellungen von Sicherheit und Ordnung in Fortbildungsprojekten für die Zusammenarbeit zwischen Sozialer Arbeit und Polizei einschreiben. Die auf dem zum Projekt dazugehörigen Handbuch sowie begleitenden Artikel bestehende kritische Analyse zeigt, wie Soziale Arbeit in diesen Formaten in sicherheitspolitische Logiken eingebunden wird und wie sich normative Erwartungen, asymmetrische Machtverhältnisse und funktionale Einpassungen in polizeiliche Strategien durchsetzen.
In einer weiteren Miniatur steht Malte Block, Leiter des „KIDS - Anlaufstelle für junge Menschen in besonderen Lebenslagen“ in Hamburg im Gespräch mit Tilman Lutz. Ausgangspunkt des Gesprächs ist die Ausgestaltung der zwangsläufigen Begegnungen mit der Polizei und der Umgang mit institutionellen Schnittmengen in der, auch aufsuchenden, Sozialen Arbeit des KIDS. Dabei wird deutlich, wie im Spannungsfeld zwischen Kontrolle, Prävention und Schutzraumgestaltung navigiert wird und welche Strategien entwickelt werden, um trotz struktureller Zielkonflikte handlungsfähig zu bleiben.
Die hochkomplexe professionelle Gestaltung von und der Umgang mit Polizeikontakten – deren Abwehr zum Schutz der jungen Menschen, aber auch das Involvieren der Polizei steht im Fokus des Interviews, dass Zoë Clark mit Rebecca Weber geführt hat.
Daniela Hunold und Rafael Behr erörtern das Verhältnis von Polizei und Sozialer Arbeit im Dialog aus der Perspektive der Polizeiforschung. Inner- oder unterhalb der von ihnen konsensual diagnostizierten polizeilichen Dominanz in situativ-alltäglichen wie strukturellen Begegnungen und Formen der Zusammenarbeit sowie differenten Aufgaben verweisen sie auf Überschneidungen, wechselseitige Bezugnahmen sowie Annäherungspraxen und -praktiken in Gegenwart und Vergangenheit, die auch zu gemeinsamen Problem(re)produktionen führen.
Der Forumsbeitrag thematisiert die Vernachlässigung von Klassismus in der Sozialen Altenarbeit, wodurch sich ein Classimperalism einer Mittelschichtsorientierung etablieren könne. Klassismus durchzieht, so die Feststellung, alle gesellschaftlichen Strukturen und kann sich im Alter verstärken. Der Beitrag analysiert diese Manifestationen von Klassismus im Alter und wirft einen kritischen Blick auf Konzepte der Sozialen Altenarbeit. Betont wird die Notwendigkeit einer klassismuskritischen Reflexion und gerechten Ressourcenverteilung in der Sozialen Arbeit mit älteren Menschen
Die Rezension von Martina Pistor beschäftigt sich mit dem 2023 erschienenen Buch „asozial – dissozial – antisozial. Wider die Politik der Ausgrenzung“ und ordnet das Buch als breites Forum für sehr unterschiedliche Kritiken am Konzept der dis-/asozialen Persönlichkeitsstörung ein.
Passend zum Thema des Schwerpunktes kritisiert der Text des Solidaritätskreis Justice4Mouhamed in der Rubrik Eingriffe&Positionen die tödliche Polizeigewalt gegen den 16-jährigen Mouhamed Lamine Dramé, der am 8. August 2022 in Dortmund während einer psychischen Krise von der Polizei erschossen wurde. Der Prozess gegen fünf Angeklagte Beamt:innen endete im Dezember 2024 mit Freisprüchen, was die Familie und Unterstützer:innen als Verweigerung von Gerechtigkeit bewerten. Der Text fordert u. A. strukturelle Veränderungen im Umgang mit psychischen Krisen, eine angemessene Unterstützung für Opfer von Polizeigewalt und Angehörige und die Entwicklung alternativer Interventionsmöglichkeiten, um weitere Todesfälle zu verhindern.
Redaktion des Heftes:
Zoë Clark
E-Mail: zoe.clark@uni-siegen.de
Fabian Fritz
E-Mail: fabianfritz@gmx.de
Moana Kahrmann
E-Mail: moana.kahrmann@uni-siegen.de
Jonas Kohlschmidt
E-Mail: jonas.kohlschmidt@haw-hamburg.de
Tilman Lutz
E-Mail: tilman.lutz@haw-hamburg.de
Arne Ragunathan Wohlfarth
E-Mail: arne.ragunathanwohlfarth@uni-siegen.de
Literatur
Clark, Zoë 2018: Children’s Dignity with a culture of Sanctioning – Images of Recipients of Child Welfare Services. In: Social Work & Society, 16 (2)
Clark, Zoë/Inhoffen, Caroline/Fritz, Fabian/Lutz, Tilman 2023: Polizeikontakte im Alltag in der Heimerziehung – keine pädagogisch relevanten Situationen? Forschungsnotizen aus einer explorativen Studie. In: Diskurs Kindheits- und Jugendforschung 2-2023, 273-278
Fritsch, Konstanze 2019: Praktische Überlegungen zur Kooperation von Sozialer Arbeit und Polizei. In: DZI – Soziale Arbeit 68, 171-179
Fritsch, Konstanze/Paustian, Mauri 2019: „Gemeinsam blaumachen?“. Erfahrungen aus der Zusammenarbeit von Jugendhilfe und Polizei. In: Unsere Jugend 71 (5), 207-214
Hanak, Gerhard/Steinert, Heinz/Stehr, Johannes 1989: Ärgernisse und Lebenskatastrophen: über den alltäglichen Umgang mit Kriminalität. Bielfeld
Laabich, Ousaama 2025: Interdisziplinäre Zusammenarbeit: Soziale Arbeit und Polizei. In: Blätter der Wohlfahrtspflege 1/2025, 27-29
Lindenberg, Michael/Lutz, Tilman 2021: Zwang in der Sozialen Arbeit. Grundlagen- und Handlungswissen. Band 38 der Reihe „Grundwissen Soziale Arbeit“. Stuttgart
Lutz, Tilman 2017: Sicherheit und Kriminalität aus Sicht der Sozialen Arbeit: Neujustierungen im Risiko- und Kontrolldiskurs. In: Soziale Passagen 2/2017, 283-297
Piñeiro, Esteban/Pasche, Nathalie/Koch, Martina 2016: Kooperative Ordnungsproduktion. Blicke auf das Verhältnis von Sozialer Arbeit und Polizei. In: SozialAktuell 6/2016, 10-14
Pütter, Norbert 2022: Soziale Arbeit und Polizei. Zwischen Konflikt und Kooperation. Stuttgart
Schaerff, Marcus/Lohrmann, Leon 2023: Der neue § 37a Abs. 2 JGG: Fallkonferenzen in Häusern des Jugendrechts auf dem Prüfstand. In: Zeitschrift für Jugendkriminalrecht und Jugendhilfe 34, 196-209
Scherr, Albert/Schweitzer, H. 2021: Gegner, Konkurrenten oder Verbündete? Zur Verbindung von Sozialarbeit und Polizei. In: SozialExtra 45, 148-155
Schuhmacher, Nils 2021: Offene Jugendarbeit und Polizei: eine Fernbeziehung auf engem Raum. In: Deinet, U./Sturzenhecker, B./von Schwanenflügel, L./Schwerthelm, M.: Handbuch Offene Kinder- und Jugendarbeit. Wiesbaden, 1787-1802
Singelnstein, Tobias/Stolle, Peer 2012: Die Sicherheitsgesellschaft. Soziale Kontrolle im 21. Jahrhundert. Wiesbaden
Steinert, Heinz 2024: Genau hinsehen, geduldig nachdenken, sich nicht dumm machen lassen. (1998) Reflexivität als Perspektive kritischer Sozialwissenschaft. In: Reidinger, V./Kufner-Eger, J./Pilgram, A./Cremer-Schäfer, H. (Hrsg.): Ist there justice? No just us! Heinz Steinerts realistischer Sinn für Utopie. Wien, 146-169
Turba, Hannu 2018: Die Polizei im Kinderschutz. Zur Verarbeitung institutioneller Komplexität in hybriden Berufswelten. Wiesbaden: Springer VS
Ziegler, Holger 2001: Crimefighters United – Zur Kooperation von Jugendhilfe und Polizei. Neue Praxis: Zeitschrift für Sozialarbeit, Sozialpädagogik und Sozialpolitik 6, 538-557