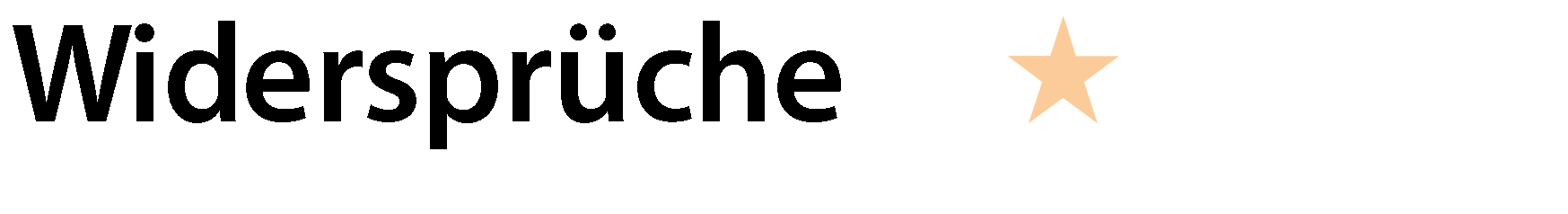Gekreuzt?! Intersektionalität und Soziale Arbeit
Schwerpunkt
Einen Aufsatz zur Intersektionalität in der hier vorliegenden Zeitschrift zu schreiben, fordert mich aus zweierlei Gründen besonders heraus: Erstens beobachte ich seit ca. fünf Jahren in der BRD ein weit verbreitetes Interesse an intersektionalen theoretischen Konzepten und empirischen Methoden von Forscher_innen und Praktiker_innen innerhalb der Sozialen Arbeit. Dies hängt wohl damit zusammen, dass Tätigkeiten in der Sozialen Arbeit direkt mit Differenzierung, Normalisierung und Andersheit verbunden sind (vgl. den entsprechenden Titel eines Buches, herausgegeben von Kessl/Plößer 2010). Die im Bereich der Sozialen Arbeit Tätigen in Praxis und Wissenschaft beschäftigen sich gerade nicht mit den sogenannten normalen Menschen, sondern mit den Anderen, den Älteren, den migrantischen Mädchen oder Jungen, den Jugendlichen ohne Ausbildung, den Ärmeren, den Asylbewerber_innen, den Drogengebrauchenden, allgemeiner gesagt den mit spezifischen Problemlagen behafteten und damit häufig an den gesellschaftlichen Rand gedrängten Menschen. Hier sind intersektionale Ansätze mit ihrem Anspruch, sich mit Wechselwirkungen von Differenzierungskategorien und deren Verwobenheit mit Dominanz, Diskriminierung und Unterdrückung auseinanderzusetzen, direkt anschlussfähig. Zweitens steht die Zeitschrift Widersprüche seit mehr als 20 Jahren für ein kritisches Denken innerhalb der Sozialen Arbeit, das sich, so meine Behauptung, mit intersektionalem Denken vertiefen lässt. Wenn sich allerdings Soziale Arbeit qua beruflichem Selbstverständnis schon immer mit unterschiedlich konstruierten Subjekten auseinandergesetzt hat - auch bevor es einen Begriff von Intersektionalität überhaupt gab, wo kann dann der kritische Stachel eines intersektionalen Ansatzes liegen?
Das Paradigma von Intersektionalität beansprucht fortwährend für neue mögliche Auslassungen, Entnennungen und Exklusionen sensibel zu bleiben (Lutz et al. 2010: 12) und so bisherige blind spots als analytische Ressource zu nutzen (Walgenbach 2010: 254). Diesbezüglich soll es in diesem Beitrag jedoch nicht darum gehen, eine weitere neue Intersektionalität zu den bisher schon beforschten hinzuzufügen. Vielmehr soll auf Marx zurückgehend an eine Tradition reproduktionstheoretisch orientierten Forschens erinnert werden, um auf diese Weise - dem Anspruch des Intersektionalitätsparadigmas folgend - Aspekte zurück in den aktuellen Diskurs zu holen, die gerade dadurch zu blind spots sich ausweiten könnten, dass sie aus diesem herauszufallen drohen. Es geht dabei nicht allein um eine Klärung des in Intersektionalitätsstudien häufig eher diffusen Klassenbegriffes. Vielmehr sollen auf der Basis grundlegender Überlegungen zur theoretischen Konstitution des Forschungsgegenstandes, auch Vorschläge zu einem diesem Gegenstand angemessenen methodisch-qualitativen Vorgehen in der Empirie bezüglich Erhebung und Analyse zur Diskussion gestellt werden.
Intersektionale Perspektiven in der Sozialen Arbeit - Ein produktiver Forschungsansatz in der Arbeit mit Drogengebrauchenden Sexarbeiterinnen In diesem Artikel möchte ich zeigen, welche Erkenntnisse durch die Verwendung eines intersektionalen Forschungsansatzes für die Soziale Arbeit gewonnen werden können. Ich werde dazu Ergebnisse aus meiner Dissertation heranziehen, in der ich mich mit der Handlungsfähigkeit von Drogengebrauchenden Sexarbeiterinnen beschäftigt habe. Am Beispiel der Drogengebrauchenden Sexarbeiterinnen lässt sich differenziert nachweisen, dass eine repressive Politik eine verheerende Wirkung auf die Situation der Betroffenen hat. Sanktionen und Verfolgungen scheinen für die Gesellschaft die einzige Möglichkeit zu sein, dem Phänomen Herr zu werden. Die Stimme der Betroffenen verstummt im Geschrei der herrschenden Diskurse, so z.B. bei den aufgeregten Diskussionen um Zwangsprostitution und Menschenhandel oder der Forderung nach Zurücknahme des 2002 eingeführten Prostitutionsgesetzes, wie es erst kürzlich Alice Schwarzer in einer Talkshow forderte.[br][br] Ich habe in meiner Dissertation 15 Drogengebrauchende Sexarbeiterinnen interviewt. Die Frauen leben und/oder arbeiten in Hamburg St. Georg. Der Stadtteil ist städtisches Aufwertungsgebiet und ist außerdem von massiven Regulierungen, wie der Gefahrengebiets- sowie Sperrgebietsverordnung und dem Kontaktanbahnungsverbot betroffen. Drogengebrauchende Sexarbeiterinnen sind auf Grund der doppelten Verletzung sozial-moralischer Normen in ihrem Alltag extremen Stigmatisierungen ausgesetzt. Sie verstoßen tagtäglich gegen mindestens zwei Gesetze, das Betäubungsmittelgesetz (BtMG) und die Sperrgebietsverordnung (SpGVo). Sie sind aus Sicht der Mehrheit nicht als handlungsfähige Subjekte erkennbar.[br][br] Es ging mir u.a. darum, politische Handlungsmöglichkeiten und Empowermentansätze, die zur Selbstermächtigung für Drogengebrauchende Sexarbeiterinnen führen, herauszuarbeiten. Forschungsleitend war die Arbeitsthese, dass in der Verweigerung von gesellschaftlichen und rechtlichen Normen und in den Verstößen gegen sie subversive Akte und Widersetzungen enthalten sind, die Handlungsfähigkeit einerseits eröffnen und andererseits beschränken können. Es ist schwierig, Empowerment in den marginalisierten Bereichen der Sexarbeit zu etablieren. Dort ist die Situation durch die Gesetzgebungen im Strafrecht, im Ausländerrecht und aufgrund der strukturellen Diskriminierung sowie massiver Vorurteile bei Ämtern und Behörden sehr kompliziert.
Eine Frage, die mich im Kontext meiner Praxiserfahrungen sowie meiner Auseinandersetzungen in empirischer Forschung schon länger beschäftigt ist, inwiefern werden Deutungsmuster sozialer Praxen (vgl. Bourdieu 1998) im Rahmen Sozialer Arbeit und daraus abgeleitete Interaktionen dem Feld oder dem Fall in seiner gesamten Komplexität gerecht? Alltags-, lebenslagen-, lebensbewältigungs- und lebensweltorientierte (vgl. May 2008) Ansätze sind heute mit die am weitesten ausformulierten analytischen sowie theoretischen Konzepte der Sozialen Arbeit, die sich versuchen der Forderung einer angemessenen Erfassung sozialer Konfliktlagen mit Einbezug der Stimme der AdressatInnen (vgl. Hamburger/Müller 2006) zu stellen. Lebensweltorientierung soll die Analyse von spezifischen Lebensverhältnissen mit pädagogischen Konsequenzen verbinden. Lebensweltorientierung hält am Ziel fest, gerechtere Lebensverhältnisse, Demokratisierung und Emanzipation und professionstheoretisch gesehen Chancen rechtlich abgesicherter, fachlich verantwortbarer Arbeit zu entwickeln (vgl. Thiersch/Grunwald/Köngeter 2005: 165). Gefordert wird in der Analyse der Lebenswelt, auch dahinterliegende gesellschaftliche Konflikte zu berücksichtigen (vgl. ebd.: 172). Damit verbindet sich im Prinzip auch ein politischer Anspruch. Und dennoch verlieren diese analytischen Modelle in Forschungskontexten sowie im berufspraktischen Alltag in aller Regel an Schärfe. Problematisch in der Umsetzung sowie in der Wahrnehmung bzw. Analyse der Lebenswelt erscheint die unzureichende Berücksichtigung gesellschaftlicher Ungleichheits- und Herrschaftsstrukturen (vgl. Schimpf/Stehr 2012: 107). In aller Regel verstricken sich die professionellen Deutungsmuster auf der Interaktionsebene und laufen dann schnell Gefahr, Konflikte im Kontext Sozialer Arbeit zu individualisieren. Die enge Verstrickung Sozialer Arbeit mit dem Widerspruch von Hilfe und Kontrolle bietet sicherlich eine Teilantwort auf diese Prozesse. So schwingt häufig im Rahmen des breit geführten öffentlichen Diskurses von Förderung und Fordern bei der Analyse von Konfliktlagen, die Menschen bewältigen, in der Regel die Verantwortungsfrage mit. Inwiefern ist der Mensch selbst für den Konflikt verantwortlich oder welche übergeordnet wirksamen Prozesse, sind für die Lage oder Situation verantwortlich?
Die Feststellung, dass eine bestimmte Gruppe von Adressat_innen, meist handelt es sich um Menschen mit Migrationsgeschichte, teilweise bewusst oder unbewusst durch fachdienstliche Soziale Arbeit ausgegrenzt und benachteiligt werden, widerspricht zunächst zentralen Anliegen Sozialer Arbeit, nämlich die Menschen zu unterstützen und ihnen zu ihrem Wohlbefinden und zu einem möglichst selbstbestimmten Leben zu verhelfen (Rommelspacher 2012: 43). Treten diskriminierende Muster im Arbeitsalltag Sozialer Arbeit auf, widersprechen diese zudem massiv dem Verständnis Sozialer Arbeit als Menschenrechtsprofession. Im Rahmen der Sozialen Arbeit als Menschenrechtsprofession wird das doppelte Mandat der Hilfe und Kontrolle um ein drittes Mandat erweitert, indem neben den wissenschaftsbegründeten Arbeitsweisen und Methoden, die ethische Basis (Berufskodex) und die Menschenrechte als Legitimationsbasis dienen (vgl. Staub-Bernasconi 2007: 200). Soziale Arbeit hilft dabei in ihrer Funktion als agency for social change in der Wahrung und Durchsetzung der Menschenrechte. Wenn Soziale Arbeit sich auf die Menschenrechte beruft, dann ist sie aufgefordert, diese in den jeweiligen Kontexten zu verteidigen und zu sichern. Ihre Aufgabe ist es, die berechtigten Anliegen der Klient(inn)en und die Erfordernisse von Professionalität an den Arbeitgeber und die Behörden heranzutragen, und die dadurch entstehenden Konflikte einerseits als zu ihrer Rolle gehörend zu behandeln, andererseits auch mit professionellen Mitteln zu bearbeiten (Olbrecht 2004, in Staub-Bernasconi 2007: 202). Soziale Arbeit ist dabei notwendigerweise politisch, da sie es mit sozialen Problemen zu tun hat, die entweder direkt durch politische Prozesse hervorgerufen oder in nicht ausreichendem Maße durch soziale Sicherungssysteme abgefedert werden. Sie beinhaltet also auch eine parteiliche Vertretung des/der Einzelnen im Kontext erlebter Diskriminierung auf den gesellschaftlichen Ebenen (vgl. Mührel/Röh 2007).[br][br] Im vorliegenden Beitrag werden nach einer theoretischen Einbettung, Fallbeispiele zu Diskriminierungsrisiken im Beratungsalltag von Fachdiensten Sozialer Arbeit vorgestellt, um dann Überlegungen anzustellen, wie diese vermieden werden können bzw. wie professionell mit den daraus entstehenden Konflikten umgegangen werden kann.
Forum
Ausgangs- und Bezugspunkt meiner Ausführungen sind die Beiträge in Widersprüche Heft 123, Einspruch! - Partizipation und Rechtsansprüche in Politik, Gesellschaft. Diese beleuchten das Für und Wider von Partizipation in der sozialen Arbeit, wobei die Mehrheit der Beiträge die ungleiche Machtverteilung in Beteiligungsprozessen und die Gefahr von Partizipation in der Post-Demokratie in den Vordergrund stellen. Hier möchte ich meinen Blick weder auf die Gefahren, noch auf die möglichen Kontrollmechanismen von partizipativen Prozessen in der sozialen Arbeit lenken, sondern meinen Fokus auf das den partizipativen Prozessen inhärente Ereignis in den Mittelpunkt stellen.
Rezensionen
Editorial
Im Editorial des Heftes 104 "'Alles schön bunt hier!' - Zur Kritik kulturalistischer Praxen der Differenz" haben wir als Redaktion der Widersprüche darüber reflektiert, warum wir uns mit Ausnahme von Geschlecht in unseren Heften kaum mit anderen sozialen Differenzkategorien und ihrer gesellschaftlichen (Re-)Produktion beschäftigt haben. Ein wesentlicher Grund dafür schien uns zu sein, "dass zumindest implizit in Marxscher Tradition darauf gehofft wurde, mit der Überwindung feudaler und kapitalistischer Verhältnisse auch diese Ungleichheiten aufheben zu können". Deutlich wird dies etwa, wenn die Redaktion in ihrem Editorial zu Heft 46/1993, "Paradoxien der Gleichheit: Menschenrechte und Minderheiten" hervorhob, dass "nach wie vor <...> die Trennung zwischen Produktionsmittelbesitzern und Arbeitskräften Ungleichheit und Unterdrückung
Hintergrund des "Alles-schön-bunt"-Heftes war denn genau auch so eine Politik in Form der vom EU-Rat verabschiedeten Richtlinien zur Gleichstellung benachteiligter Gruppen und deren bundesrepublikanischer Umsetzung im "Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG)". Diesbezüglich beanspruchte das Heft die widersprüchlichen Effekte, Möglichkeiten und Begrenzungen zu analysieren, die sich mit diesem "horizontalen" oder "Zielgruppen übergreifenden Ansatz" als wenig genau gefasster Politik mit universalerem Horizont einerseits und seine Umsetzung beispielsweise in Diversity-Trainings als Instrumente zur Problematisierung und Aufklärung sozialer Ungleichheiten andererseits verbinden. In kritischer Weiterentwicklung ihrer alten Positionen stützte sich die Redaktion dabei auf eine "Perspektive, die soziale Verhältnisse als Kontext kultureller und geschlechtlicher Differenzen einbezieht". "Die konkreten Möglichkeiten, vor allem aber Grenzen solcher Strategien" hat sie in dieser Weise "im Anschluss an Antonio Gramsci als 'Kompromiss'
Unzweifelhaft ist auch die Konjunktur, die der Diskurs um Intersektionalität in den letzten Jahren in Europa und der Bundesrepublik zu verzeichnen hat, nicht unabhängig von diesem politischen Hintergrund zu sehen. Allerdings hat der Begriff von "Intersektionalität" (intersection = Straßenkreuzung) eine sehr viel weiter zurückliegende Geschichte, die sich in ihren verschiedenen Verästelungen bis heute fortsetzt und in ihrer eigenen Weise - ähnlich wie die Diskriminierungen und Herrschaftsverhältnisse, an denen sich die jeweiligen politischen Projekte abarbeiten - überkreuzen. Zurück geht der Begriff der Intersektionalität auf die US-amerikanische Juristin Kimberlé Crenshaw (vgl. 1989: 149), der zufolge sich manche Diskriminierungserfahrungen Schwarzer Frauen weder durch gender noch race allein, sondern nur durch deren Überkreuzung erklären lassen. Schon vorher wurde vom sozialistischen Teil der ersten Frauenbewegung die spezifische Situation von Frauen aus der Arbeiterklasse problematisiert oder in Amerika eine Verbindung des Kampfes um Frauenrechte und Sklavenbefreiung gesucht.
Während sich Philomena Essed (1991) auf die beiden Dimensionen "vergeschlechtlichte Rassismen" gendered racisms> und "rassifizierte Sexismen" racist genderisms> beschränkte, hob Angela Davis 1981 mit "Women, Race & Class" schon lange vor Crenshaw jene "großen Drei" hervor, die bis heute in der Intersektionaliäts-Debatte ein herausgehobene Bedeutung einnehmen. Fiona Williams (vgl. 1989) hat diesen die Kategorien Alter, Behinderung und Sexualität hinzugefügt, "um aus den 'großen Drei' die 'großen Sechs' zu machen" (Hearn 2010: 105). Helma Lutz und Norbert Wenning (2001: 20) identifizierten schließlich dreizehn Kategorien und Charlotte Bunch (2001) sogar sechzehn.
Beinahe scheint es so, als ob durch einen in das Konzept fest eingebauten Regress die Untersuchung unendlich vieler Überschneidungen von Differenzlinien geradezu provoziert wird. Ja, es wird sogar explizit das Potential der Intersektonalitätsstudien hervorgehoben, "fortwährend für neue mögliche Auslassungen, Entnennungen und Exklusionen sensibel zu bleiben" (Lutz et al. 2010: 12) und so "bisherige blind spots als analytische Ressource zu nutzen" (Walgenbach 2010: 254). Empirisch stellt sich dann jedoch zugleich die Frage, zu welchen Zeiten, an welchen Orten und in welchen Situationen welche Kategorien und Intersektionalitäten wie relevant werden.
Hinzu kommt, dass sich solche Intersektionalitäten auch noch auf sehr verschiedene Weise in allen möglichen Epistemologien interpretieren lassen. Neben "interkategorialen" Analysen, welche auf die Beziehungen zwischen verschiedenen sozialen Kategorien zielen, werden von Leslie McCall (2005) in dieser Weise auch "intrakategoriale" Ansätzen unterschieden, welche die wechselnden Ein- und Ausschlusskriterien problematisieren, nach denen jemand an einem bestimmten Ort und zu einer bestimmten Zeit unter eine bestimmte Kategorie subsumiert wird. Solche "inter-" und "intrakategorialen" Ansätze schließen sich jedoch keineswegs aus, weshalb Katharina Walgenbach (2005: 48) im bundesrepublikanischen Diskurs den Begriff "interdependente Kategorien" vorgeschlagen hat, um damit über die wechselseitigen Abhängigkeiten intrakategorialer "Konfigurationen" hinaus, deren zugleich auch interkategorial heterogene Strukturierung hervorzuheben.
Neben "inter-" und "intrakategorialen" unterscheidet McCall auch noch "antikategoriale" Ansätze. Gegenüber einer solchen ausschließlich dekonstruktivistisch-"antikategorialen" Perspektive wird jedoch eingewandt, dass sich "die Machteffekte, die diese Kategorien generieren, geschichtlich und gesellschaftlich tief eingeschrieben
Unabhängig davon, ob sie sich auf die Figur der Intersektionalität stützen oder sich als Alternativen dazu zu profilieren trachten, beschränken sich viele dieser Untersuchungen so nicht allein auf eine Analyse multipler sozialer, wirtschaftlicher und politischer Bedrohungen, wie z.B. der von Deborah King (vgl. 1988) formulierten Ansatz der "multiple jeopardies" (Mehrfachgefährdungen). Vielmehr wurden und werden solch eher additive Konzeptionen auch durch andere Modelle zu überwinden versucht. Zu verweisen wäre hier beispielsweise auf Patricia Hill Collins (vgl. 1991) "matrix of domination", in deren Rahmen sie eine Analyse des "interlocking systems of oppression" von race, class und gender vorzunehmen versucht. Während jedoch Crenshaws Modell der Intersektion eine schnelle Verbreitung erfuhr und Eingang in unterschiedliche Forschungsfelder und Politikbereiche fand, gelang dies anderen Begriffsbildungen, die das gleiche Ziel verfolgten, nicht in diesem Maße. Als Grund vermutet Nira Yuval-Davis (2010), dass Crenshaws Straßenkreuzungsmethapher sofort ein intuitives Verständnis über den Gegenstand der Debatte hervorruft.
An diese Metapher angelehnt finden sich in der Debatte weitere "heuristische Termini wie Verschränkungen, Schnittpunkte, Durchkreuzungen, Überschneidungen" (Walgenbach 2010: 248) oder Differenz-"Achsen" (Yuval-Davis 2006). "Alternative Entwürfe favorisieren bspw. offenere Konzepte, die sich in Termini wie 'Konfigurationen' (Gutiérrez Rodríguez 1996) oder 'soziale Dynamiken' (Cooper 2004) ausdrücken" (Walgenbach 2010: 248). Vor diesem Hintergrund wird deutlich, weshalb Katarina Walgenbach die Erfolgskriterien, welche von Kathy Davis (2010) angeführt werden, um den Theorieanspruch der Intersektionalitätsstudien zu untermauern, eher "an die Paradigmadefinition von Thomas S. Kuhn
Erklärt für Kathy Davis (vgl. 2010) gerade die Offenheit, Unschärfe und Ambiguität des Konzeptes dessen akademischen Erfolg, mahnen Helma Lutz, Maria Teresa Herrera Vivar und Linda Supik (2010: 18) Intersektionalität nicht von seiner Geschichte als politisches Projekt abzukoppeln. Gemeinsam mit Rudolf Leiprecht hat Helma Lutz (vgl. 2005: 221ff.) darüber hinaus vorgeschlagen, dass intersektionale Theoriebildung sich an bestimmten Mindeststandards orientieren sollte, die bspw. festlegen, dass soziale Kategorien als Resultat von Machtverhältnissen analysiert werden. Selbst darüber gibt es jedoch keinen Konsens, plädiert doch Nira Yuval-Davis dafür, "dass sich die Intersektionalitätsanalyse nicht auf jene beschränken sollte, die sich an den vielfältigen Rändern der Gesellschaft befinden, sondern dass sie alle Mitglieder der Gesellschaft einschließen sollte - Intersektionalität sollte somit als der theoretische Bezugsrahmen für die Analyse sozialer Schichtung bzw. Klassen betrachtet werden" (2010: 190).
Hier diagnostizieren Lutz et al. jedoch "Übersetzungsprobleme zwischen dem Antidiskriminierungsdiskurs und dem Ungleichheitsdiskurs <...>, bzw. Schwierigkeiten bezüglich der Verhältnisbestimmung von Ungleichheit und Diskriminierung zueinander" (Lutz et al. 2010: 16). Sie vermuten, dass "möglicherweise <...> aus ungleichheitssoziologischer Sicht <...> zu wenig wahrgenommen
Weil Machtverhältnisse sich in dieser Weise "nicht auf eine Ebene reduzieren" (Walgenbach 2010: 253) ließen, müssten "sich intersektionale Analysen auf unterschiedlichen Ebenen
So wird in diesem Diskurs darum gerungen, wie Differenz und soziale Ungleichheit sich analytisch aufeinander beziehen lassen, wobei ja Ungleichheitsmechanismen, die mit entsprechenden Differenzlinien verbunden sind, sich durchaus auch widersprüchlich überlagern können. Die gesellschaftstheoretische Einbettung von mehreren "Achsen der Ungleichheit" bzw. "Achsen der Differenz" und ihre Vermittlung mit den Erfahrungen der Subjekte steht zur Diskussion. Zudem stellt sich die Frage, auf welcher Ebene die Wechselwirkungen ansetzen und in welchen zu untersuchenden Kontexten welche Differenzkategorien relevant werden. Dies betrifft auch die Soziale Arbeit, die nicht nur die Aufgabe hat, Probleme sozialer Ungleichheiten zu bearbeiten, sondern durch die von ihr durchadministrierten Kategorien zugleich an der Produktion entsprechender Differenzlinien beteiligt ist. Das Heft der Widersprüche nimmt einerseits diese theoretischen und methodologischen Fragen auf und zeigt zugleich an empirischen Studien das analytische Potenzial dieses Ansatzes.
Zu den Beiträgen im Einzelnen
Der Themenschwerpunkt dieses Heftes wird eröffnet durch den Beitrag von Gabriele Winker "Intersektionalität als Gesellschaftskritik". In diesem sucht sie ihren gemeinsam mit Nina Degele 2009 der Öffentlichkeit vorgestellten "praxeologischen intersektionalen Mehrebenenansatz", der seit dem vor allem in genderforschungsinteressierten Kreisen breit rezipiert wurde, nach drei Seiten hin zu akzentuieren und weiterzudenken. So hebt sie zunächst noch einmal den von ihrer Seite mit diesem Forschungsansatz verbundenen Anspruch hervor, eine differenzierte Analyse der heutigen kapitalistischen Gesellschaft zu leisten. Damit verbunden arbeitet sie bezüglich des praxeologischen Moments dieses Ansatzes heraus, dass um zum einen Subjektkonstruktionen, zum anderen auch die sozialen Positionierungen einzelner Akteur_innen differenziert herausarbeiten zu können, eine solche Mehrebenenanalyse konsequent subjektwissenschaftlich ausgerichtet sein muss im Sinne der an die Arbeiten Klaus Holzkamps anschließenden Kritischen Psychologie.
In seinem Beitrag "Das Pradigma von Intersektionalität und das Erbe eines kritisch-reproduktionstheoretisch orientierten Forschens in der Tradition von Marx" schließt Michael May direkt an Winkers Reformulierung ihres mit Nina Degele entwickelten "praxeologischen intersektionalen Mehrebenenansatz" an. Den Kapitalismusanalyse-Anspruch von Winker aufgreifend stellt er - auf Marx zurückgehend - grundlegende Überlegungen zur theoretischen Konstitution des Forschungsgegenstandes zur Diskussion, um damit - dem Anspruch des Intersektionalitätsparadigmas folgend - auch Aspekte zurück in den aktuellen Diskurs zu holen, die sich gerade dadurch zu blinden Flecken ausweiten könnten, da sie aus diesem herauszufallen drohen. In diesem Zusammenhang setzt er einen besonderen Akzent auf eine Klärung des in Intersektionalitätsstudien häufig eher diffusen Klassenbegriffes. Darüber hinaus unterbreitet er in kritischer Auseinandersetzung mit dem praxeologischen Moment von Winker/Degeles intersektionalen Mehrebenenansatz sowie ihrer Analyse von Subjektkonstruktionen und Repräsentationen Vorschläge zu einem der theoretischen Gegenstandsbestimmung angemessenen methodisch-qualitativen Vorgehen in der Empirie. Dabei greift er auch Winkers subjektwissenschaftliche Vorschläge auf und versucht diese weiterzudenken.
Dass Winker/Degele mit ihrem intersektionalitätsanalytischen Ansatz ein Instrumentarium vorgelegt haben, das für eine handlungsorientierte Sozialforschung und Praxis gerade auch im Feld Sozialer Arbeit genutzt und ausgebaut werden kann, verdeutlichen die nächsten beiden Beiträge. Im Artikel "Intersektionale Perspektiven in der Sozialen Arbeit - Ein produktiver Forschungsansatz in der Arbeit mit Drogengebrauchenden Sexarbeiterinnen" zeigt Kathrin Schrader, welche Erkenntnisse sich dadurch subjektwissenschaftlich vor allem bezüglich der Handlungsfähigkeit dieser intersektional vielfältig diskriminierten Frauen gewinnen lassen. Auf der Grundlage von Interviews mit fünfzehn Drogen gebrauchender Sexarbeiterinnen aus Hamburgs städtischem Aufwertungsgebiet St. Georg, vermag sie nicht nur zu zeigen, wie in deren Missachtung des Betäubungsmittelgesetzes und der Sperrgebietsverordnung subversive Akte und Widersetzungen enthalten sind, die Handlungsfähigkeit einerseits eröffnen und andererseits beschränken können. Entgegen deren vielfältiger intersektionaler Diskriminierung sowie massiver Vorurteile bei Ämtern und Behörden hat sie auf diese Weise zugleich für jede einzelne Frau politische Handlungsmöglichkeiten und Empowermentansätze herausgearbeitet, die zu deren Selbstermächtigung führen. Diese hat sie dann im Anschluss zu drei verschiedenen Typen komprimiert.
Auch Nicole von Langsdorff verdeutlicht in ihrem Beitrag "Intersektionalitätsanalytischer Ansatz im Kontext von Jugendhilfe" unter Bezug auf aktuelle Diskurse im Kontext von Intersektionalität und Diversity, sowie vor dem Hintergrund von Forschungsarbeiten im Kontext erzieherischer Hilfen, den Gewinn eines Mehrebenenansatzes der Intersektionalität für die Soziale Arbeit. Gestützt auf zehn biographisch narrative Interviews mit Mädchen und jungen Frauen zwischen 13 und 18 Jahren, die zum Interviewzeitpunkt in Einrichtungen der Heimerziehung nach § 34 SGB VIII lebten, konzentriert sich ihre intersektionalitästanalytische Untersuchung auf die Frage nach den Konstellationen, die für diese auf den Weg in die Erziehungshilfen bedeutsam waren. Aus den von ihr auf diese Weise exemplarisch an einem Fall analysierten Konflikten, arbeitet sie schwerwiegende Beeinträchtigungen der Mädchen und jungen Frauen im Kontext von Klasse, Geschlecht, Herkunft/Ethnizität und/oder Körper heraus, die über entsprechend mangelhafte materielle und rechtliche Rahmenbedingungen diese ihre Lebensziele nicht im angestrebten Maße verwirklichen lassen.
Abgeschlossen wird der Themenschwerpunkt des Heftes durch den Beitrag "Diskriminierungsrisiken im Beratungsalltag" von Susanne Dern und Ulrike Zöller. Dieser nimmt seinen Ausgangspunkt an dem Widerspruch, dass trotz der Funktion Sozialer Arbeit als "agency for social change" in der Wahrung und Durchsetzung der Menschenrechte teilweise bewusst oder unbewusst Adressat_innen im Zuge bestimmter Intersektionalitäten auch durch fachdienstliche Soziale Arbeit ausgegrenzt und benachteiligt werden. Nach einer theoretischen Einbettung präsentieren die beiden Autorinnen Fallbeispiele zu Diskriminierungsrisiken im Beratungsalltag von Fachdiensten Sozialer Arbeit, um daran Überlegungen anzuschließen, wie diese vermieden werden können bzw. wie professionell mit den daraus entstehenden Konflikten umgegangen werden kann.
Die Redaktion
Literatur
Bunch, Charlotte 2001: A women's human rights approach to the World Conference Against Racism. Center for Women's Global Leadership. Online verfügbar unter www.cwgl.rutgers.edu/globalcenter/policy/gcpospaper.html
Cooper, Davina 2004: Challenging diversity. Rethinking equality and the value of difference. Cambridge ;, New York: Cambridge University Press
Crenshaw, Kimberlé W. 1989: Demarginalizing the intersection of race and sex: a Black feminist critique of antidiscrimination doctrine, feminist theory and antiracist politics. In: University of Chicago Legal Forum (139), S. 139-167
Davis, Angela Y. 1981: Women, race & class. 1. Aufl. New York: Vintage Books
Davis, Kathy 2010: Intersektionalität als "Buzzword": Eine wissenschaftssoziologische Perspektive auf die Frage "Was macht eine feministische Theorie erfolgreich ?". In: Helma Lutz, Maria Teresa Herrera Vivar und Linda Supik (Hg.): Fokus Intersektionalität. Bewegungen und Verortungen eines vielschichtigen Konzeptes. 1. Aufl. Wiesbaden: VS Verlag, S. 55-68
Essed, Philomena 1991: Understanding everyday racism. An interdisciplinary theory. 1. Aufl. Newbury Park
Gutiérrez Rodríguez, Encarnación 1996: Frau ist nicht gleich Frau, nicht gleich Frau, nicht gleich Frau... Über die Notwendigkeit einer kritischen Dekonstruktion in den feministischen Forschung. In: Ute-Luise Fischer, Marita Kampshoff, Susanne Keil und Mathilde Schmitt (Hg.): Kategorie: Geschlecht? Empirische Analysen und feministische Theorien. Opladen: Leske u. Budrich, S. 163-190
Hearn, Jeff 2010: Vernachlässigte Intersektionalitäten in der Männerforschung: Alter(n), Virtualität, Transnationalität. In: Helma Lutz, Maria Teresa Herrera Vivar und Linda Supik (Hg.): Fokus Intersektionalität. Bewegungen und Verortungen eines vielschichtigen Konzeptes. 1. Aufl. Wiesbaden: VS Verlag, S. 105-123
Hill Collins, Patricia 1991: Black feminist thought. Knowledge, consciousness, and the politics of empowerment. New York: Routledge
King, Deborah K. 1988: Multiple Jeopardy, Multiple Consciousness: The Context of Black Feminist Ideology. In: Signs: Journal of Women in Culture and Society 14 (1), S. 42-72.
Leiprecht, Rudolf; Lutz, Helma 2006: Intersektionalität im Klassenzimmer. Ethnizität, Klasse, Geschlecht. In: Rudolf Leiprecht und Anne Kerber (Hg.): Schule in der Einwanderungsgesellschaft. Ein Handbuch. 2. Aufl. Schwalbach/Ts: Wochenschau-Verl., S. 218-234.
Lutz, Helma; Wenning, Norbert 2001: Differenzen über Differenz - Einführung in die Debatten. In: Helma Lutz und Norbert Wenning (Hg.): Unterschiedlich verschieden. Differenz in der Erziehungswissenschaft. Opladen: Leske + Budrich, S. 11-24
Lutz, Helma; Herrera Vivar, Maria Teresa; Supik, Linda 2010: Fokus Intersektionalität - eine Einleitung. In: Helma Lutz, Maria Teresa Herrera Vivar und Linda Supik (Hg.): Fokus Intersektionalität. Bewegungen und Verortungen eines vielschichtigen Konzeptes. 1. Aufl. Wiesbaden: VS Verlag, S. 9-30
McCall, Leslie 2005: The Complexity of Intersectionality. In: Signs: Journal of Women in Culture and Society (3), S. 1771-1800
Walgenbach, Katharina 2005: "Die weiße Frau als Trägerin deutscher Kultur". Koloniale Diskurse über Geschlecht, "Rasse" und Klasse im Kaiserreich. Frankfurt/Main ; New York: Campus
Walgenbach, Katharina 2010: Postscriptum: Intersektionalität - Offenheit, interne Kontroversen und Komplexität als Ressourcen eines gemeinsamen Orientierungsrahmens. In: Helma Lutz, Maria Teresa Herrera Vivar und Linda Supik (Hg.): Fokus Intersektionalität. Bewegungen und Verortungen eines vielschichtigen Konzeptes. 1. Aufl. Wiesbaden: VS Verlag, S. 245-256
Williams, Fiona 1989: Social policy. A critical introduction: issues of race, gender, and class. Cambridge, UK, Oxford, UK;, New York, NY, USA: Polity Press; Blackwell.
Yuval-Davis, Nira 2006: Intersectionality and feminist politics. In: European Journal of Women's Studies 13 (3), S. 193-209
Winker, Gabriele; Degele, Nina 2009: Intersektionalität. Zur Analyse sozialer Ungleichheiten. Bielefeld: Transcript
Yuval-Davis, Nira 2010: Jenseits der Dichotomie von Anerkennung und Umverteilung: Intersektionalität und soziale Schichtung. In: Helma Lutz, Maria Teresa Herrera Vivar und Linda Supik (Hg.): Fokus Intersektionalität. Bewegungen und Verortungen eines vielschichtigen Konzeptes. 1. Aufl. Wiesbaden: VS Verlag, S. 185-201